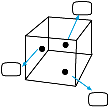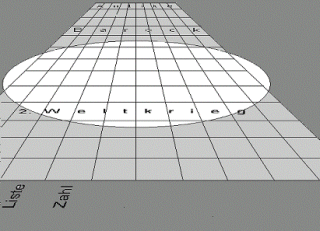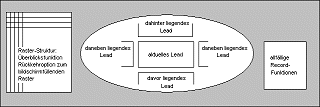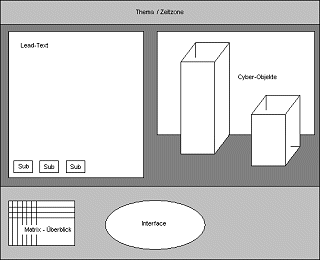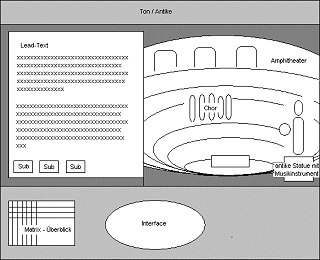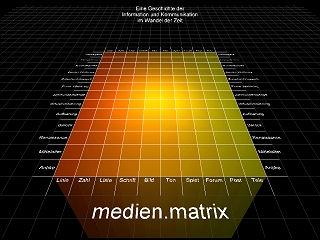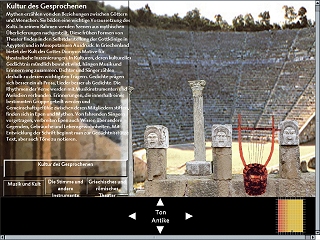|
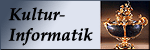 |
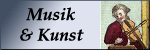 |
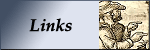 |
| © 1996-2025 by |
Wunderkammer Cyberspace?
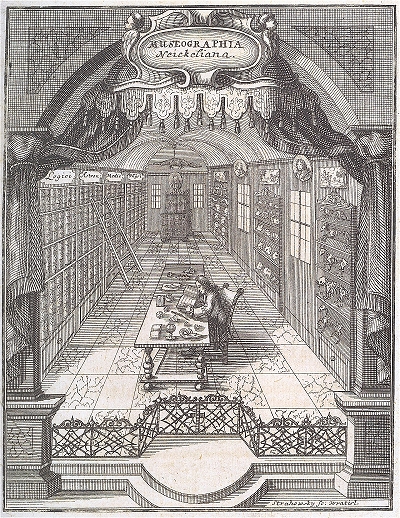
Gestaltung und Rolle digitaler Museumsinformationssysteme
Illustriert anhand der medien.matrix am Technischen Museum Wien
von
Leonhard Huber
betreut durch
ao.Univ.-Prof. Mag. Dr. Dieter Merkl
Kurzreferat
Die vorliegende Arbeit hat zum Ziel, die Rolle und Gestaltung digitaler Informationssysteme in Museen zu definieren und zu bewerten. Um dies zu erreichen, werden folgende Themenkreise angesprochen: die Aufgabe von Museen als Institutionen für die Öffentlichkeit, die Konzeption von digitalen Informationssystemen und die gegenseitigen Abhängigkeiten zwischen inhaltlicher Struktur und graphischer Gestaltung anhand eines praktischen Beispieles.
Erfahrungen, die europäische Museen im Rahmen von Projekten mit digitalen Medien gemacht haben, dienen als Ausgangspunkt. Die Arbeit untersucht zunächst die Rolle von digitalen Medien als Informationsvermittler anhand von Mensch-Computer-Interaktion. Sie vergleicht hierzu unterschiedliche Modelle und Strukturen, die bei computergestützter Informationsaufbereitung angewandt werden.
In einem zweiten Teil hebt die Arbeit die praktische Umsetzung mehrerer theoretischer Aspekte hervor. Die während der Konzeption der medien.matrix - ein digitales Besucherinformationssystem am Technischen Museum Wien - gewählte Vorgangsweise zur Strukturierung, Gestaltung und Bewertung wird vorgestellt.
Die signifikantesten Ergebnisse der Arbeit können wie folgt zusammengefaßt werden: Museen haben primär eine Bildungsaufgabe zu erfüllen. Virtuelle Informationsräume können keine realen Ausstellungen ersetzen, sondern sie vielmehr komplettieren; die einzige Ausnahme stellen virtuelle (Online-)Museen dar, die über keinerlei physische Objekte verfügen. Graphische Gestaltung kann nur dann didaktische Unterstützung leisten, wenn die zugrundeliegende inhaltliche Basis klar strukturiert ist.
Die Arbeit schließt mit einigen Gedanken zu den Ressourcen und Faktoren, die für eine zukünftige Wissensgesellschaft unabdingbar sind.
Schlagworte:
Museum, Informationssystem, Mediengeschichte,
Inhaltsorganisation, graphische Gestaltung, Softwarelösung
Abstract
This thesis aims to define and evaluate the role and design of digital information systems in museums. In order to do this, the study addresses the following topic areas: the tasks of museums as institutions for the public, the conception of digital information systems and the interdependencies between content structure and graphic design, illustrated by a practical example.
Experiences made by European museums in digital media projects have served as a starting point. The report investigates the role of digital media as information mediators by looking at Human Computer Interaction and compares different models and structures used for computer-based information provision.
In a second part, the paper outlines the practical use of several theoretical aspects by presenting the design and evaluation approach carried out during the conception of the medien.matrix, a digital visitor information system at the Vienna Museum of Technology.
The most significant outcomes of the research can be summarized as follows:
Museums primarily have an educational task to fulfill. Virtual information spaces
cannot replace real exhibitions but can only complement them, the exception
being virtual (online) museums, which lack physical objects. A graphic design
can only provide didactic support if the content basis is clearly structured.
The paper concludes with some thoughts about the resources and factors which
are sufficient for a future knowledge society.
Keywords:
media history, museum, information system,
content organisation, graphic design, software solution
Executive Summary (Zusammenfassung)
Zielsetzung der vorliegenden Arbeit ist es, die Rolle und Gestaltung digitaler Informationssysteme in Museen als Informationsvermittlungsinstrumente näher zu definieren. Als Beispiel dient die medien.matrix, ein Informationssystem zur Mediengeschichte, das für die Ausstellung medien.welten am Technischen Museum Wien konzipiert wurde.
Fragen:
- Ist das Museum der Zukunft der Unterhaltung oder der Vermittlung von Wissensinhalten verpflichtet?
- Soll reale Objektpräsentation zugunsten virtueller Simulation zurückgedrängt werden?
- Wie muß zwischen Inhalt (Wissen) und Form (Gestalt) gewichtet werden, damit ein Informationssystem seine Vermittlungsaufgabe erfüllen kann?
Hypothesen:
- Museen erfüllen eine Bildungsaufgabe, zu deren Umsetzung zeitgemäße Kulturtechniken heranzuziehen sind.
- Digitale Vermittlung ist kein Ersatz für reale Unmittelbarkeit, aber eine sinnvolle Ergänzung.
- Graphische Umsetzung orientiert sich an inhaltlichen Vorgaben.
Ergebnisse:
- Bildung stellt das zentrale Ziel jeder musealen Vermittlungstätigkeit
dar.
Jedoch muß eine ansprechende Aufbereitung der Wissensinhalte erfolgen, die der jeweiligen Zielgruppe gerecht wird. - Digitale Vermittlung ergänzt reale Didaktik.
Da virtuelle Museen auf physische Objektpräsentation verzichten müssen, stellen sie eine Ausnahme dar. - Inhaltliche Strukturierung soll für den Anwender nachvollziehbar sein.
Andernfalls kann Graphik keinerlei didaktische Unterstützungsfunktion erfüllen.
Mein Dank gilt zunächst Herrn ao.Univ.-Prof. Mag. Dr. Dieter Merkl, der
mir mit wertvollen Tips und aufschlußreichen Hinweisen hilfreich zur Seite
stand.
Außerdem danke ich meinen Kolleginnen und Kollegen am Technischen Museum
für zahlreiche Gespräche und fachliche Detailinformationen. Mein besonderer
Dank gilt Herrn Dipl.-Ing. Dr. Otmar Moritsch, Herrn Mag. Wolfgang Pensold sowie
Herrn Dr. Mirko Herzog. Weiters möchte ich Herrn Mag. Dr. Herwig Walitsch,
Herrn Mag. Martin Reinhart sowie Herrn Mag. Hermann Tragner für ihre Unterstützung
danken.
Herr Michael Mikolajczak stellte sich mir freundlicherweise für ein telefonisches
Interview zur Verfügung. Für weitere zweckdienliche Hinweise danke
ich Herrn Mag. Dr. Fritz Betz, Frau Magda Szopa, Herrn Christoph Bart sowie
Frau Sabine Eder.
Inhaltsverzeichnis
KURZREFERAT
ABSTRACT
EXECUTIVE SUMMARY (ZUSAMMENFASSUNG)
EINLEITUNG
STAND DER FORSCHUNG
Wissen als Wettbewerbsvorteil
Bildung oder/und Vergnügen
Durchführung von Multimedia-Projekten
Typologie von Informationssystemen
Zusammenfassung
MEDIEN ALS INFORMATIONSVERMITTLUNGSINSTRUMENTE
Medientheoretische Ansätze
Ausstellungskonzept der medien.welten
Computer als Ausstellungsinhalt und Vermittlungsinstrument
HUMAN-COMPUTER INTERACTION
Human (Benutzer)
Computer (Digitale Technologien)
Interaktion
Software-ergonomische Aspekte
INFORMATIONSAUFBEREITUNG
Modelle zur Vermittlung digitaler Inhalte
Strukturierungswerkzeuge
Informationscontainer der medien.matrix
GRAPHISCHE GESTALTUNG
Visualisierter Informationsraum
Skizzierte Entwürfe der medien.matrix
Graphische Umsetzung der medien.matrix
SOFTWARETECHNISCHER LÖSUNGSANSATZ
Auswahl geeigneter Technologien
Konkrete Implementierung
Datenaufbereitung mit PHP, VRML und HTML
EVALUATION
Testdaten
Nutzen einer Bewertung
Akzeptanztest
ERGEBNISSE DER ARBEIT
DIE ZUKUNFT DER WISSENSVERMITTLUNG
LITERATURVERZEICHNIS
ABBILDUNGSVERZEICHNIS
Einleitung 
Museums are for people to explore and learn from collections for understanding and inspirations. They are institutions that collect, safeguard, and make accessible artefacts and specimens, which they hold in trust for society.
So versucht die British Museums Association (2002) die Aufgabenbereiche der Institution Museum zu umreißen. In dieser Aussage wird auf zwei Interessensgruppen Bezug genommen. Die erstere setzt sich aus Besuchern zusammen, die ein bereicherndes Erlebnis erwarten und an Weiterbildung interessiert sind. Zum anderen bezieht sich das genannte Zitat auf die Sammlungskuratoren und Historiker, die wissenschaftliche Forschung betreiben und ihre Ergebnisse in Form von Schausammlungen, welche sich aus ausgewählten Exponaten zusammensetzen, zugänglich machen.
Der öffentliche Auftrag, den die Gesellschaft an die Museen stellt, besteht darin, Sachverhalte an Hand konkreter Objekte aufzuarbeiten. Das Museum hat - im Gegensatz zu einer Bibliothek - den Vorzug der authentischen Vermittlung und ermöglicht damit (sieht man von Vitrinen als schützenden Vorrichtungen ab) Inhalte nachvollziehbarer und »begreifbarer« zu gestalten.
Der einzigartige Charakter von Musealität (der Präsentation authentischer Objekte in einer Schausammlung) wird besonders dann deutlich, wenn man die Anfänge der Institution Museum betrachtet. Diese lassen sich auf die Kunst- und Wunderkammern zurückführen, die seit der Renaissancezeit von kunstsinnigen Herrschern angelegt und gepflegt wurden, wie etwa am Hofe Rudolf II. in Prag. In Florenz traten die Medici als Mäzene des Kunsthandwerkes hervor. Einerseits wurden Kunstwerke, andererseits seltene Naturschätze gesammelt. Zum Inventar zählten nicht nur Gemälde, Plastiken und kunstgewerbliche Arbeiten sondern auch Mineralien, Edelsteine, exotische Pflanzen und Tiere.
Samuel Quiccheberg (1529-1567) sah die Kunstkammer als eine mit der Bibliothek verbundene, überschaubare, durch reichliche Inschriften erläuterte Enzyklopädie alles Wissbaren. (Laue 2000, zit. nach Theuerkauff, 1981)
Seit mehr als zweihundert Jahren sind Museen öffentlich zugängliche Orte, die ihrem Zielpublikum Gegenstände aus Natur, Kunst und Technik präsentieren. Die Wissenschaft Museologie setzt sich mit den Musealien (Exponaten) als Bedeutungsträgern auseinander und kontextualisiert sie im Rahmen einer Sammlung bzw. Ausstellung. Hier genau liegt der Anknüpfungspunkt zum Thema dieser Arbeit. Mit dem Zeitalter der Informationsgesellschaft hat die computergestützte Forschung und Präsentation ins Museum Einzug gehalten.
Welche didaktische Aufgaben ein digitales Informationssystem in einer Ausstellung erfüllen kann, und welche Rolle dabei das Thema der nachvollziehbaren Inhaltsaufbereitung spielt, sollen die folgenden Ausführungen erläutern. Ausgegangen wird von der Annahme, daß die strukturierte Organisation und Verknüpfung von Inhalten den zentralen und wesentlichsten Punkt in der Konzeption eines digitalen Museumsinformationssystems darstellt. Graphische Gestaltung und technische Umsetzung werden als Mittel zum Zweck betrachtet, um die didaktische Qualität zu sichern und somit die Informationsvermittlung zu unterstützen.
Zur Illustration dieser Hypothese wird die medien.matrix, eine elektronische
Präsentationsplattform der Ausstellung medien.welten am Technischen
Museum Wien, herangezogen. Anhand dieses praktischen Beispiels, das vom Autor
als Prototyp-System in Zusammenarbeit mit dem Konzeptteam am TMW realisiert
worden ist, werden die Wechselwirkungen und gegenseitigen Abhängigkeiten
von Inhaltsorganisation, graphischer Gestaltung und technischer Umsetzung (Programmierung),
die sich bei der Konzeption eines digitalen Museumsinformationssystems ergeben,
dargestellt und bewertet.
Die Arbeit gliedert sich in verschiedene Abschnitte, die im folgenden kurz angeführt
sind.
Im Kapitel »Stand der Forschung« wird auf die Aufgabe/Verpflichtung heutiger Bildungsinstitutionen hingewiesen, als Wissensvermittler aufzutreten. Die Rahmenbedingungen für museale Tätigkeiten werden anhand der aktuellen Rechtslage in Österreich dargestellt.
Der Abschnitt »Medien als Informationsvermittler« stellt das Ausstellungskonzept der medien.welten vor. Die Erfahrungen einiger thematisch verwandter Institutionen im Einsatz computergestützter Informationssysteme werden dargestellt.
Das Kapitel »Human-Computer Interaction« nimmt Bezug auf die Gestaltung und den Ablauf des Kommunikationsprozesses zwischen Benutzer und Computersystem.
Der Bereich »Informationsaufbereitung« befaßt sich mit Modellen der digitalen Inhaltsvermittlung und der Strukturierung von Inhalten für ein Museumsinformationssystem. Nachvollziehbare und bekannte Werkzeuge zur Informationsorganisation werden im Hinblick auf ihre Vermittlungsleistung und ihren Einsatz im Museumskontext untersucht.
Im Kapitel »Graphische Gestaltung« wird versucht, auf den Einsatz der Visualisierung von Information einzugehen. Software-ergonomische Aspekte sowie konkrete Design-Entwürfe der medien.matrix werden vorgestellt.
Im Abschnitt »Softwaretechnischer Lösungsansatz« wird der Prototyp im Hinblick auf seine konkrete Implementierung präsentiert. Es handelt sich um eine Softwarelösung, die aktuelle Internet-Technologien miteinander verknüpft und versucht, die inhaltliche Strukturierung und graphische Präsentation möglichst direkt in entsprechenden Datenformaten abzubilden.
Das Kapitel »Evaluation des Systems« stellt
Bewertungsmethoden vor und präsentiert die Werkzeuge/Ergebnisse eines Benutzertests
des Prototypen. Verschiedene Kriterien, wie unter anderem die Übersichtlichkeit
der Benutzeroberfläche, die Nachvollziehbarkeit der inhaltlichen Strukturierung
und die Detaillierung der Inhalte werden überprüft.
In »Ergebnisse der Arbeit« erfolgt eine zusammenfassende
Darstellung der Hypothesen und signifikantesten Resultate.
Abschließend wird versucht, einen Ausblick auf die »Zukunft
der Wissensvermittlung« zu geben.
|
Museen als Bildungsinstitutionen |
Museumsinformationssysteme |
medien.matrix |
|||
|
Wissensvermittlung in Ort und Zeit |
Didaktik durch Ausstellung bzw. Informationsraum |
Informationssystem zur Mediengeschichte |
|||
|
Historizität |
Gegenwartsbezug |
Realität, |
Virtualität, Cyberspace |
Text, |
Bild/Ton, |
|
Speicher, bewahren |
Forum, |
Objekt, |
Information, Kontext |
Konzeption |
Präsentation |
|
Individuum |
Gruppe |
Präsentation |
Interaktion |
Navigation |
Information |
|
Bildung, Sammlung |
Unterhaltung, Zerstreuung |
analoge Codierung, Monomedialität |
digitale Codierung, Multimedialität |
Inhalt |
Form (Graphik, Technik) |
|
Detail, Vertiefung |
Überblick, |
klassifiziert, |
vernetzt, |
Struktur, |
Element, |
|
Kunst, |
Wirtschaft, |
Materialität, |
Immaterialität, Simulation |
abstrakt |
konkret |
Stand der Forschung 
Wissen als Wettbewerbsvorteil 
Informationell autonom zu sein bedeutet nicht, all das Wissen präsent zu haben, das zur Lösung eines aktuellen Problems gebraucht wird (...), wohl aber in der Lage zu sein, selber auf die Informationsressourcen, die auf den Märkten im Prinzip verfügbar sind, zugreifen und sie produktiv nutzen zu können. (Kuhlen 1999)
Im Zeitalter der Informationsgesellschaft ist ein exponentiell-explosiver Anstieg der Datenmengen zu verzeichnen. Immer mehr wird geforscht, aufgearbeitet und publiziert. Doch damit ergeben sich für den Einzelnen, der an einem bestimmten Wissensgebiet interessiert ist, viele Fragen. Wie ist es ihm überhaupt möglich, sich im Dickicht der weltweit virtuell und physisch verfügbaren Informationen zurechtzufinden? Täglich wächst die Zahl der Homepages und Datenbanken im WWW. Doch wie kann der Durchschnittsnutzer aus der Menge unspezifischer, redundanter Blei- und Byte-Wüsten, die auf »cut & paste«-Technik sowie mangelhafte Recherche seitens der Autoren zurückzuführen sind, jene Informationen herausfiltern, die genau seinen Bedarf abdecken und für seine Fragestellung relevant sind?
Durch die Chance, weltweit elektronisch publizieren zu können, hat sich das Internet in Teilen zu einer wahren Fundgrube wertvollen Spezialwissens entwickelt. Doch noch ist das globale Datennetz weit davon entfernt, vollständig oder semantisch indexiert zu sein.
Man kann nicht nur erleben, »lost in Hyperspace« zu sein, auch Bildungs- und Forschungseinrichtungen lassen Anfragen von Informationsbedürftigen bisweilen unbeantwortet. Häufig läßt sich feststellen, daß eine Wissenskluft zwischen einer großen Anzahl interessierter Konsumenten und einer verhältnismäßig kleineren Gruppe elitär gesinnter Forscher besteht, die teilweise den Kontakt zur Allgemeinheit meiden.
Der Informationsbedarf ist hoch, das Angebot an entsprechenden Antworten reicht von ausführlichen bis zu verweigerten. Es liegt an verschiedensten öffentlichen und privaten Institutionen, sich der Rolle des Informationsvermittlers bewußt zu sein und dementsprechend zu agieren. Schulen, Fachhochschulen, Universitäten, Forschungseinrichtungen (Science Center), Bibliotheken, Archive und Museen sind dabei besonders gefordert, ihrem Auftrag gegenüber der Gesellschaft nachzukommen: Informationen anzubieten und aufzubereiten. Wie groß die Menge des stillen Wissens ist, das weder in gedruckter noch in digitaler Form vorliegt, ist kaum abzuschätzen.
There may be millions of fine thoughts, and the account of experience on which they are based, all encased within stone walls of acceptable architectural form; but if the scholar can get only one a week by diligent search, his syntheses are not likely to keep up with the current scene (Bush 1945)
Scienceweek @ Austria nennt sich eine Initiative, welche die diversen Forschungsaktivitäten wissenschaftlicher Einrichtungen Österreichs einem breiten Publikum zugänglich machen soll. Die Betonung liegt bei dieser besonderen Form der Öffentlichkeitsarbeit auf einer verständlichen und unterhaltsamen Form der Präsentation, um Neugierde und Interesse zu wecken.
People's emotions and feelings will be targeted, rather than their minds. Albert Einstein could serve as a model: He was impressed by the 'beauty' of formulae, and he was not afraid of explaining even complicated concepts to a larger public in a lively and illustrative way. (Pharos 2001)
Bildung oder/und Vergnügen 
Der öffentliche Auftrag des Museums besteht darin, Museumsbesuchern durch die Begegnung mit den Ausstellungsexponaten Anregungen zu geben und Weiterbildung zu ermöglichen. Ein durchdachtes Ausstellungskonzept ist die Grundvoraussetzung erfolgreicher Museumsdidaktik. Es ermöglicht einen individuellen Rundgang durch die Sammlungsbereiche und setzt durch die Auswahl von Exponaten und die räumliche Aufteilung entsprechende inhaltliche Akzente. Der Ausstellungswert eines Objektes sollte sich an zwei Kriterien orientieren: der Beurteilung des wissenschaftlichen Wertes durch einen Fachexperten und einem Bezugspunkt für die Zielgruppe interessierter Besucher.
Gegenwärtig stehen die betreffenden Institutionen, nicht zuletzt als Folge der fortschreitenden europaweiten Privatisierung der Museen und der damit verbundenen Kürzungen staatlicher Unterstützung, vor einer Richtungsentscheidung. Sollen vermehrt Sponsoren eingebunden werden, um die finanziellen Engpässe zu verringern, besteht die Gefahr, daß sich Ausstellungen zu Werbe-Veranstaltungen für Firmen entwickeln. Oftmals sind nicht nur die Marketing-Maßnahmen davon betroffen, es gibt die - berechtigte - Befürchtung, daß privatwirtschaftliche Geldgeber nicht nur ihren Namen, sondern auch ihre Produktpalette in die Ausstellung integrieren.
In der Verordnung des Bundesministers für Unterricht und kulturelle Angelegenheiten
wird die Museumsordnung des Teschnischen Museums Wien (TMW) wie folgt definiert.
Allgemeine Zweckbestimmung
§ 2. Die allgemeine Zweckbestimmung des TMW liegt entsprechend dem Bundesmuseen-Gesetz darin, seine Sammlungen zu bewahren, auszubauen, zu erschließen und der Öffentlichkeit zugänglich zu machen. Dabei sind die Sammlungen zu pflegen, zu dokumentieren und zu ergänzen. Die Erschließung und Präsentation der Sammlungen folgt wissenschaftlichen und didaktischen Kriterien, orientiert sich am
Stellenwert des TMW in der nationalen und internationalen Museumswelt und berücksichtigt gesellschafts- und kulturpolitische Aufgaben. Dieser allgemeine Zweck des TMW ist unter Beachtung der Grundsätze der Zweckmäßigkeit, Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit zu verfolgen.
Besondere Zweckbestimmung
§ 3. Die besondere Zweckbestimmung des TMW wird durch die von ihm bewahrten Zeugnisse und den inneren Zusammenhang, in dem diese stehen, präzisiert: (...)
5. die Bestände sind der Öffentlichkeit zu präsentieren. Dazu sind sie entsprechend ihrer naturwissenschafts- und technikgeschichtlichen Bedeutung in einer den Erkenntnissen der modernen Museologie und Museumsdidaktik entsprechenden Form auszustellen;
6. spezifische Themen sind durch Sonderausstellungen in einen erweiternden und vertiefenden Kontext zu stellen: neue Erkenntnisse, aktuelle Themen und Schwerpunkte der eigenen Sammlungen und eigenen Forschungen. Ebenso sind aktuelle Forschungsergebnisse aus dem universitären Bereich sowie neue Produkte und Verfahren aus Wirtschaft und Industrie laufend zu präsentieren; (...)
10. das TMW hat in einen Diskurs mit allen Alters- und Bildungsgruppen unserer Gesellschaft zu treten. Ziel ist die Förderung des Wissens über die Rolle der Naturwissenschaften und Technik als integraler Bestandteil unserer Zivilisation, die Förderung eines verantwortungsbewussten Umgehens mit Technik und eine sachliche Information für Jugendliche und Kinder. So ist die Zusammenarbeit mit außerschulischen Jugendbetreuungseinrichtungen, mit Schulen aller Bildungsstufen, mit Volksbildungsanstalten, Volkshochschulen und Einrichtungen der Erwachsenenbildung eine besondere Verpflichtung für das TMW;
(BGBl. Teil II, Artikel 507 1999)
Der vorliegende Gesetzestext fordert wesentliche Punkte ein, die zu den Zielsetzungen
und Tätigkeitsbereichen von Museen im allgemeinen zählen. Im Zentrum
der Aufgaben stehen wissenschaftliche Erschließung und Wissensvermittlung
in Form von Ausstellungen an alle Schichten der Gesellschaft. Weiters wird die
Bedeutung einer zeitgemäßen und kontextualisierten Aufbereitung der
Sammlungsinhalte hervorgehoben. Die Museumsordnung des TMW entspricht dem generellen
Bestreben, wissenschaftliche Forschung einer breiten Öffentlichkeit zugänglich
zu machen.
Museen sind heutzutage zu adäquater Didaktik verpflichtet, jedoch sind z. B. die österreichischen Bundesmuseen - zu denen auch das TMW zählt - als wissenschaftliche Anstalten öffentlichen Rechts von privatwirtschaftlichen Geldgebern abhängig:
[Museen] sind wissenschaftliche Anstalten öffentlichen Rechts des Bundes, denen unbewegliche und bewegliche Denkmale im Besitz des Bundes zur Erfüllung ihres kulturpolitischen und wissenschaftlichen Auftrags als gemeinnützige öffentliche Aufgabe anvertraut sind und die mit In-Kraft-Treten der Museumsordnung (§ 6) eigene Rechtspersönlichkeit erlangen. (BGBl. I, Nr. 142/2000)
(...) das TMW arbeitet eng mit Sponsoren, Mäzenen und Förderern zusammen. Dies ist für den ökonomischen Erfolg des TMW als Anstalt mit eigener Rechtspersönlichkeit unabdingbar, wobei die wirtschaftliche Zielvorgabe in der kontinuierlichen Erhöhung des Eigendeckungsbeitrages
besteht.
(...) Die Aufgabenstellung des TMW (§§ 2 und 3) ist nach wirtschaftlichen Grundsätzen in möglichst effektiver Weise durchzuführen. Mit dem erzielten Gewinn sind Aufgaben des TMW zu finanzieren. Zu diesem Zweck werden im Rahmen des Bereiches Sponsoring und Marketing alle Aktivitäten des TMW zusammengefasst, die auf eine marktgerechte Positionierung des Hauses im Tourismus- und Freizeitmarkt und als Partner der Wirtschaft abzielen und die profitorientiert sind. Dazu gehört insbesondere auch die Gewinnung von Sponsoren. Diese Aktivitäten sind im Einvernehmen mit der Geschäftsführung in einer Weise durchzuführen, die der Würde und dem Ansehen des Hauses angemessen sind. (BGBl. Teil II, Artikel 507, 1999)
Die Museumsordnung des TMW spricht unzweifelhaft die bereits genannte Richtungsentscheidung an, mit der sich Bildungsinstitutionen im Dienste der Öffentlichkeit derzeit konfrontiert sehen. Einerseits sollen Museen ökonomisch effektiv agieren, sich der gesamten Eigendeckung der Betriebskosten kontinuierlich nähern und gewinnorientiert produzieren. Sponsoren sollen gezielt angesprochen werden, um dies zu ermöglichen. Andererseits entzieht sich der österreichische Staat mit diesen offenbar wohlmeinenden Hinweisen stillschweigend seiner Verantwortung, dafür zu sorgen, daß der eingeforderte Bildungsauftrag umgesetzt wird und auch tatsächlich erfüllbar bleibt (Budget). Phrasen wie "marktgerechte Positionierung" oder "Museen als Partner der Wirtschaft" sind zweifellos unterschiedlich auslegbar.
Das zweite Zeitphänomen, mit dem sich die Museen konfrontiert sehen, ist
das Konkurrenzprogramm, das Vergnügungsparks und Unterhaltungszentren zur
Freizeitgestaltung anbieten. Spaß und Zerstreuung werden angeboten, wogegen
das Museum doch ursprünglich seinen Besuchern Freude und die Möglichkeit
mentaler Sammlung bietet. (vgl. Waidacher 2000)
Gleichgültig ob nun Museumsbesucher von heute an Bildung oder aber an Zerstreuung interessiert sind, sobald sie das Museum betreten, erwarten sie ein multisensuales Erlebnis. Nachvollziehbare Aufbereitung von Ausstellungsinhalten, die real und/oder virtuell erfolgen kann, leistet einen wertvollen Beitrag.
Doch gilt es zu beachten, daß sich physische Objektpräsentation durch Vermittlung von Authenzität auszeichnet, während Terminals mit digitalen Angeboten sich eher dazu eignen, eine erklärende und ergänzende Rolle anzunehmen. Computergestützte Vermittlung kann reale Präsentation aber auch durch eine zusätzliche, eigenständige Ebene ergänzen. Digitale Schichtaufnahmen von Gemälden fördern beispielsweise Informationen zu Tage, die für das menschliche Auge ohne Hilfsmittel unsichtbar sind.
Museumsinformationssysteme fördern auf elektronischem Wege Interesse für
bestimmte Themenbereiche, indem sie vertiefende Zusatzinformationen zur realen
Schausammlung entsprechend präsentieren. Die Aufmerksamkeitsspanne des
Museumsbesuchers ist meist kurz. Daher muß gesichert sein, daß digitale
Medien Interesse wecken, einen persönlichen Bezug zu präsentierten
Themen herstellen und den Rezipienten nicht mit unbewältigbaren Wissensmengen
überfrachten.
Durchführung von Multimedia-Projekten

Hat man sich für den Einsatz multimedialer Stationen innerhalb einer Ausstellung entschieden, so erfordert deren Realisierung sorgfältige Planung. Die erfolgreiche Vermittlung der Inhalte wird durch die Erstellung eines schlüssigen inhaltlichen Konzeptes und eines realistischen Projektplanes gewährleistet.
Bei der Ausarbeitung der einzelnen Teile der Multimedia-Anwendung soll definiert sein, welche Arbeitspakete an externe Projektpartner vergeben (Outsourcing) und welche Tätigkeiten hausintern durchgeführt werden sollen. Ein entsprechendes Projektteam setzt sich aus Fachwissenschaftern, Material-Rechercheuren, Graphikern, Technikern, Finanzplanern, Public Relations-Beauftragten und Rechtsberatern zusammen.
Nicht nur während der Erstellung der eigentlichen Multimedia-Anwendung,
sondern auch nach deren Implementierung in die Ausstellung soll überlegt
werden, welches didaktische Vermittlungskonzept dem Rezeptionsverhalten der
entsprechenden Besucherzielgruppe gerecht wird. Außerdem ist auf die Aktualisierung
von Inhalten sowie deren Zugänglichkeit und Verwertung (Ausstellungsführer,
Website, CD-ROM bzw. DVD, Video) Bedacht zu nehmen.
Typologie von Informationssystemen 
Besucherinformationssysteme sind Applikationen, die über Informationsterminals bzw. Medienstationen den Besuchern bei der Besichtigung einer Ausstellung zur Verfügung stehen. Informationsterminals sind oftmals zentral in die Ausstellungsarchitektur eingebunden und sollen zur Benützung anregen, "Point Of Information" sein. Die Palette reicht hierbei von Stand-alone Personal Computern mit CRT-Monitor, Tastatur und Maus bis hin zu vernetzten Lösungen, die über spezielle Interfaces (z.B. Touchscreens oder VR-Ausrüstung) bedient werden.
Die optischen Speichermedien CD-ROM bzw. DVD haben den Vorzug, große Datenmengen mit Portabilität zu verbinden. Textmengen von einigen hunderttausend A4-Seiten lassen sich digital ablegen, mit auditiven und graphischen Elementen kombinieren. Durch die Verfügbarkeit von entsprechender Hardware (CD-ROM-Laufwerk, Graphik in Echtfarben und Soundkarte) und Software (Betriebssysteme mit graphischer Benutzeroberfläche) - speziell in Europa, Amerika und Japan - erfreuen sich Inhalte auf CD-ROM bzw. DVD großer Beliebtheit. Multimediale Lexika, virtuelle Kunstgalerien und Computerspiele zählen zu den meistverkauften Inhalten. Beispiele für entsprechende Zusammenstellungen sind die Encyclopedia Britannica, Microsoft Art Gallery oder etwa Myst.
Homepages bzw. Websites: Durch die Verbreitung der ursprünglich textbasierten
Internettechnologien außerhalb des akademischen Bereiches und das Bestreben
nach einer auch für Nicht-Techniker geeigneten Schnittstelle zum weltweitem
Wissens- und Erfahrungsaustausch angeregt, suchte Tim Berners Lee nach einer
Lösung und entwickelte 1989 am Schweizer Forschungszentrum CERN das World
Wide Web. Mit dem Aufkommen des World Wide Web entstanden zahlreiche Homepages
verschiedenster Museen bzw. entsprechender Interessensgruppen. Durch eine Website
kann das Museum auf elektronischem Wege kostengünstig Öffentlichkeitsarbeit
leisten.
Zusammenfassung 
Zusammenfassend läßt sich feststellen, daß sich die Wissensvermittlung in Museen in einer Phase des Umbruches befindet, wie die untenstehende Graphik verdeutlicht. Bewährte Präsentationsformen werden durch "neue" digitale Vermittlungsmethoden ergänzt.
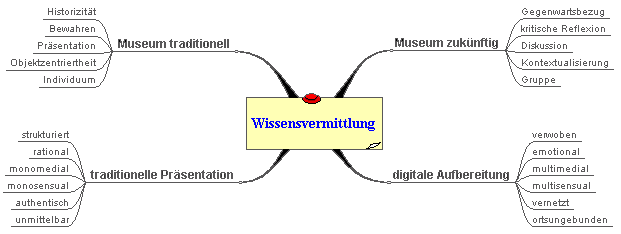
Abbildung 1: Traditionelle und zukünftige Wissensvermittlung
Medien als Informationsvermittler 
Medientheoretische Ansätze 
Der Begriff "Medium" wird unterschiedlich definiert. So heben einige Theorien den technologischen Aspekt eines Mediums hervorgehoben. Andere Ansätze betrachten vornehmlich mediale Funktionen in der Gesellschaft und Konstellationen von Sender und Empfänger (Mediendispositive), während es auch Standpunkte gibt, die vorwiegend den Inhalt medial gestützter Kommunikation betrachten.
Kommunikationswissenschafter beschäftigen sich mit den Medien als Werkzeugen
menschlicher Kulturtechnik, die dazu dienen, Botschaften über räumliche
bzw. zeitliche Distanz verfügbar zu machen. Medien speichern bzw. übermitteln
Information. Mittels Speichermedien kann flüchtige Information festgehalten
werden, Botschaften sind somit über längere Zeiträume bewahrt.
Übermittlungsmedien machen Information über räumliche Distanzen
verfügbar, sie sind Werkzeuge zur Kommunikation.
Charakteristisch ist dabei, daß Medien nicht als neutrale Träger oder Überträger von Informationen gelten, sondern als Techniken, welche die Möglichkeiten der Kommunizierbarkeit von Informationen konstituieren. (Kloock, D. & Spahr A. 2000, S.8)
Daher muß eine Codifizierung erfolgen, damit Information medial vermittelbar ist, wobei das gewählte Werkzeug die zu übermittelnde Botschaft beeinflußt. Medien erweitern als Informationsvermittlungsinstrumente die Sinnesreichweite des Menschen und bestimmen somit ebenso die subjektive Wahrnehmung der Umwelt:
Die beiden fundamentalen medialen Prinzipien Speicherung (Gedächtnis) und Übermittlung (Medialität), die aus den Gegebenheiten der realen Umwelt des Menschen (genauer aus deren zwei zentralen Dimensionen Raum und Zeit) resultieren, sind als menschliche Strategien zu verstehen, um sich im natürlichen Raum-Zeit-Gefüge effizienter bewegen zu können. (Pensold 2001, S. 5)
Auf den folgenden beiden Seiten werden einige wenige medientheoretische Ansätze
beispielhaft präsentiert, um dem Leser die Unterschiedlichkeit der Betrachtungsweisen
der Thematik näher zu bringen. Der Verfasser stützt sich auf Kloock
D. (2000).
Walter Benjamin behandelt in seinem Essay "Das Kunstwerk im Zeitalter
seiner technischen Reproduzierbarkeit" gesellschaftliche und technische
Bedingungen der Apperzeption (Wahrnehmung) anhand der Medien Photographie und
Film. Er sieht ein durch technische (nicht-manuelle) Methoden vervielfachtes
Kunstwerk in seiner Authenzität entwertet: An die Stelle des einmaligen
Originals tritt die massenhafte Kopie.
Diese Reproduktionen sind erfaßbarer, greifbarer als ihre Vorlagen, denen
man sich in Museen und Konzertsälen ehrfurchtsvoll nähert: die medialen
Techniken der Reproduktion (lösen) die elitären Strukturen der Kunst
(auf). An die Stelle von Verehrung oder Unverständnis ist Beurteilung getreten.
Den Film sieht Benjamin als manipulatives Werkzeug an, Produktionen der amerikanischen
Filmindustrie betrachtet er als uniforme Reproduktionen des Alltags: Ihr Geschäft
ist Ideologie, ihr Ziel die Stabilisierung des Systems (...) Das Publikum soll
demnach gewöhnt werden an das, was ist.
Marshall McLuhan ist der Ansicht, daß im "Zeitalter der Elektrizität"
die lineare und kausale Beweisführung - verknüpft mit dem Medium Buch
- überholt sei. Er fordert neue Formen des Denkens, die den gesellschaftlichen
Veränderungen gerecht werden. Mosaike sollen lineare, konsistente Schemata
ablösen. McLuhan ist von seinem Ansatz sehr überzeugt: (Die) Linearität
deduktiver oder induktiver Logik (grenzt) den Reichtum der Wahrnehmung aus und
erschwert zudem durch ihre geschlossene Form das Mit- und Weiterdenken. McLuhan
ist an den Wirkungen der Medien auf den Menschen interessiert, er bewertet den
Inhalt eines Mediums als belanglos; vielmehr zeige sich die Botschaft eines
Mediums in seiner Einflußnahme auf die Gesellschaft.
Technische Medien stellten Wahrnehmungsprothesen für den menschlichen Körper
dar. Sie hypnotisierten - bis zum "Ende der Gutenberg-Galaxis" - ihre
Benutzer. So habe etwa der Buchdruck - beschränkt auf Rationalität
und Visualität - sinnliche Wahrnehmung verdrängt. Befreiung von der
durch (traditionelle) Medien gegebenen unausgewogenen Sinnesmodalität werde
durch die Elektrizität erreicht: In der Vision vom automatisierten Weltdorf
stellen Menschen Produkte ausschließlich durch Programmierung her. Somit
sieht McLuhan die Determinanten der Natur bezwungen und meint, ein "Goldenes
Zeitalter" herannahen zu sehen.
Neil Postman betrachtet Medien als Werkzeuge des kommunikativen Austausches
in einer Kultur. Die menschliche Wahrnehmung sei abhängig von den verschiedenen
medialen Formen, und mit ihr das Gefühl für Raum und Zeit. Postman
betrachtet Medien einerseits als Werkzeuge (physische Transportsysteme) und
andererseits als Ersatzsprachen (Buchdruck, Telegraphie, Photographie usw.),
die gewisse Anwendungsmöglichkeiten erlauben.
Über das Fernsehen meint Postman, es häufe lediglich Informationsbruchstücke
an. Indem das Fernsehen eine diskontinuierliche Kunst- und Phantasiewelt zeigt,
die Effekte produziert, die uns lachend, weinend oder verblüfft reagieren
läßt (...), werden wir infantilisiert.
Im Zuge fortschreitender Technokratie schwindet der Glaube an die menschliche
Urteilsfähigkeit dahin. In einem vorhergesagten Technopol werde Technologie
zum Mythos hochstilisiert, der im menschlichen Bewußtsein fix verankert
sei.
Vilém Flusser analysiert den Umgang einer Kultur mit Informationen,
ihre Art zu kommunizieren. Er sieht die Schriftkultur durch "technische
Bilder" abgelöst. Ihr Aufkommen setzt Flusser mit dem Ende der Geschichte
gleich. Er fordert die Aufgabe des Anspruchs auf "absolutes Wissen",
auf eine knebelnde Sprachverbindlichkeit(...) (und bringt damit) "Wahrheit"
mit Evidenz (...), mit Kohärenz (...) und/oder mit Konsens (...) in Verbindung.
Er legt zwei verschiedene Optionen dar: Die auf eine "nachgeschichtliche"
Informationsgesellschaft hinführenden, "deutenden" Medientechnologien
können sowohl die Gesellschaft zerstören, sie kollabieren, in einer
sinnlosen Informationsflut ersticken lassen; sie können aber auch das menschliche
Bewußtsein, seine ästhetische Erlebnisfähigkeit zu ungeahnten
Höhen führen.
Flussers Informationsbegriff ist sehr grundlegend gefaßt: Informieren
heißt für ihn zunächst schlichtweg "Form in etwas zu bringen".
Der Schuhmacher "informiert" den Schuh. Der Benutzer des Schuhs bekommt
die Information, das heißt, er dekodiert sie, ist der verstehende Empfänger,
indem er den Schuh als Schuh nutzt.
Die menschlichen Akteure der telematischen Gesellschaft arbeiten gegen die Entropie,
das Aufkommen von Rauschen, Chaos, Desinformation. Sie nutzen eine vernetzte
dialogische Struktur zur Kommunikation, in der es keine Autoritäten gibt.
"Einbildner" wirken der unaufhaltsamen Eigendynamik technologischer
Forschung entgegen.
Ausstellungskonzept der medien.welten 
Die medien.welten präsentieren - als permanenter Schausammlungsbereich des Technischen Museums Wien - ab Februar 2003 die geschichtliche Entwicklung der Medien. Verschiedenste mediale Prinzipien werden auf einer realen Ausstellungsfläche von insgesamt 2.500 Quadratmetern und in einem digitalen Netzwerk den Besuchern vorgestellt.
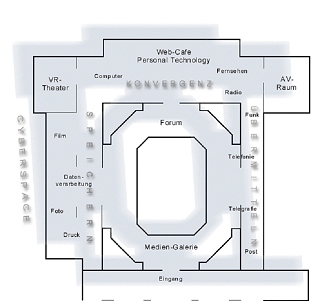
Abbildung 2: Ausstellungsgrundriß der medien.welten
Wesentlichstes Moment in der Gestaltung des realen Ausstellungsbereiches ist die Nutzung räumlicher Gegebenheiten. Die Ausstellungsarchitektur gibt klare Leitlinien vor, die zur Entwicklung des Konzeptes einer "Medienkathedrale" geführt haben.
Die beiden Längstrakte thematisieren historische Aspekte der Informationsspeicherung
(Themengruppen: Bild, Druck und Rechnen) sowie der Übermittlung (von Post
und Telegraphie bis Rundfunk und Fernsehen). Der abschließende Quertrakt
zeigt die gegenwärtige Medienlandschaft: Das Phänomen der Konvergenz,
die sich durch computergestützte digitale Datenverarbeitung ergibt, wird
illustriert und den Besuchern interaktiv zugänglich gemacht.
Die Galerie stellt - als räumliches Zentrum der Ausstellung - Schlüsselobjekte in der Entwicklungsgeschichte der Medienlandschaft ikonenhaft in den Vordergrund. An den Eckpunkten der Galerie repräsentieren "Altarbilder" historische und aktuelle Vertreter von Informationsspeicherung und -übermittlung.
Zusätzlich umfaßt die Ausstellung einen virtuellen Informationsraum, den "Cyberspace".
Zielsetzung für die Gestaltung des digitalen Netzwerks war es, die reale Präsentation zu komplettieren. Der digitale Teil der medien.welten wird die Besucher anregen, sich vertiefend mit bestimmten Inhalten auseinanderzusetzen. Mediengeschichte soll - im Gegensatz zur realen Präsentation, die sich an einzelnen Exponaten orientiert - in ihren sozialhistorischen Zusammenhängen gezeigt werden. Wichtig ist weiters eine möglichst nahtlose Überleitung von der Schausammlung in den virtuellen Informationsraum.
So entstanden im Sommer 2001 die ersten Vorschläge für die Gestaltung
des virtuellen Informationsraumes, die der Autor gemeinsam mit dem Konzeptteam
der Ausstellung der medien.welten als Prototyp-System umsetzte.
Computer als Ausstellungsinhalt und Vermittlungsinstrument

Die Frage, was computerbasierte Inhaltsvermittlung in Ausstellungen leisten kann, wird im folgenden beispielhaft illustriert.
Das Ars Electronica Center in Linz blickt mittlerweile auf eine mehr als zwanzigjährige
Entwicklungsgeschichte zurück, die 1979 ihren Anfang im Ars Electronica
Festival nahm. Gerfried Stocker, Geschäftsführer des Ars Electronica
Centers in Linz, meint zum Entstehen des "Museums der Zukunft":
Der wesentlichste Grund seines Entstehens ist (...) [das] gewachsene Wissen um die Notwendigkeit eines zukunftsorientierten Umgangs mit Gegenwart. Ein Wissen, das Voraussetzung ist, sich im Vorfeld der kulturellen Entwicklung den zu Anbeginn programmierten Zielbereichen Kunst, Technologie und Gesellschaft als einem gemeinsamen Aufgabenbereich zu stellen. Das Haus entstand als offene Werkstatt, in der kreative Intelligenz ihr Vermögen an den Geräten [Computer, Anm.] und dadurch deren Leistung erprobte. (...) Der Mensch als Teil der Informationsgesellschaft ist mit der Notwendigkeit konfrontiert, sich einzurichten im "elektronisch- digitalen Raum", sich zu behaupten zwischen den Faszinationen unseres High-Tech-Environments und einer notwendigen kritischen Reflexion und Distanz (Janko, S., Leopoldseder, H., Stocker G. 1996, S. 46ff).
Ulf Hashagen berichtet in seinem Artikel "Von Mäusen und Medien" (Weitze 2001, S. 121ff.) über seine Tätigkeit im Bereich der Konzeption neuer Medien am Heinz Nixdorf MuseumsForum in Paderborn.
(...) der Computer tritt in der Dauerausstellung des HNF nicht nur als Ausstellungsobjekt auf, sondern wird in großem Maße als Vermittlungsmedium genutzt. Funktionsprinzipien werden multimedial erläutert und historische Persönlichkeiten vorgestellt. Eigene rein multimediale Installationen stehen ebenfalls zur Verfügung.
Hashagen unterscheidet zwischen selektiver und interaktiver computerbasierter Inhaltsvermittlung. Während erstere ein Auswählen gewünschter Information über verschiedene Menüpunkte erfordert, ist bei letzterer eine freiere Navigation durch die entsprechenden Inhalte möglich. Um die Nutzung der einzelnen Multimedia-Stationen am HNF zu ermitteln, wurden die Benutzeraktionen aufgezeichnet und statistisch ausgewertet. Es zeigte sich, daß die Besucher die interaktiven Stationen nur mäßig frequentierten. Etwa neun bis zehn von täglich ungefähr zweihundertfünfzig Besuchern nahmen das digitale Angebot in Anspruch. Die Dauer der Auseinandersetzung mit digitalen Ausstellungsinhalten betrug durchschnittlich zweieinhalb Minuten. Dazu Hashagen:
Weder Schulunterricht noch Ausstellungen werden per se besser oder attraktiver, wenn Multimedia oder Neue Medien als technische Mittel eingesetzt werden. (...) Multimedia ist für Ausstellungen ein Mittel wie Text, Bilder und Funktionsmodelle. Man sollte gute Gründe für den Einsatz von Multimedia-Anwendungen haben, die häufig dreidimensionalen Objekte im Museum in nur zweidimensionale virtuelle Objekte umzusetzen. (Weitze 2001, S. 138)
Suzanne Keene, tätig am Science Museum in London und zur Zeit freie Museums- und Medienkonsulentin, meint zu den Themen Telelernen und lebenslanges Lernen:
Museums have traditionally concentrated on schools in their educational activities, but if they moved more consciously into the role of information provision then they would certainly find that they had a lot to offer to higher education students, too. All the predictions are that "lifelong lerning" is going to be the future for further education, and this could be a significant field for museums. (Keene 1998, S. 30)
Keene sieht in der virtuellen Präsentation das Potential eines weltweiten
Zuganges. (ebd., S. 31) Eine offene Informationspolitik aller Bildungsinstitutionen
ist ihrer Ansicht nach die notwendige Basis einer funktionierenden Wissensgesellschaft,
in der Museen eine wichtige Vermittlerrolle einnehmen. (vgl. ebd., S. 27)
Human-Computer Interaction 
Mensch-Computer-Interaktion beschäftigt sich mit der Konzeption, Umsetzung und Bewertung interaktiver Computersysteme. Den Mittelpunkt der HCI-Forschung bildet der Kommunikationsvorgang zwischen Mensch und Maschine. HCI analysiert computergestützte Informationssysteme und kombiniert verschiedene Ansätze aus Psychologie, Soziologie und Ingenieurswesen mit Computerwissenschaft.
Bei der Planung und Realisierung von Softwaresystemen beschränken sich
die Bemühungen von Computertechnikern zeitweise auf die Optimierung von
Programmabläufen mittels entsprechendem Quellcode. Dabei ist aber die Betrachtung
des Nutzungskontextes der Software notwendig, die leider oft vernachlässigt
wird. Clifford Stoll formuliert dies in seinem Buch "LogOut" auf treffende
Art und Weise:
Unsere Probleme haben ihre Wurzel eher in einer allzugroßen Liebe zu technischem Firlefanz und in der Vorstellung, dass die Probleme, die uns die Technologie heute beschert, von noch besserer Technologie behoben werden, deren Erfindung kurz bevorsteht. (Stoll 1999, S. 14)
Stolls Aussage bezieht sich auf Hard- und Software-Hersteller, die im Sog des
technologischen Fortschrittsdenkens gefangen sind und kommerziell einträchtige
Strategien verfolgen.
Im Zeitalter der graphischen Benutzeroberfläche mit ihren Bild-Metaphern von Papierkörben und Schreibtischordnern sind Rückblenden zu Leistungen von Programmieren geworden, High-Tech-Gurus, die sich in Assemblersprache miteinander verständigen. (Johnson 1997, S. 27)
Dieses Zitat verdeutlicht, daß es an den Nutzern als Endkonsumenten liegt, ihre Anforderungen präzise zu definieren.
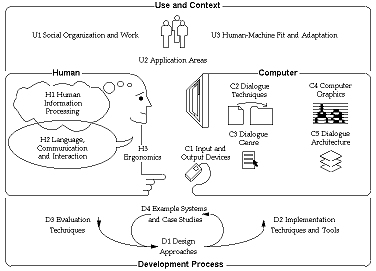
Abbildung 3: Human-Computer Interaction - Umfeld
Human (Benutzer) 
Computer werden genutzt, um bestimmte Aufgaben digital-gestützt erfüllen zu können. Doch wie lassen sich deren Benutzer charakterisieren? Sie weisen bestimmte Merkmale auf, die jedoch bisweilen ganz verschiedene Formen und Werte annehmen können. Die Vorgangsweise der Benutzer beim Einsatz von Informationstechnologie können stark variieren und werden unter anderem bestimmt durch statistische Größen wie Alter und Geschlecht, kultureller Hintergrund (Sprache, Abstammung, Traditionen), Ausbildung, Computerliterarität (Routine in der Benutzung von Informationstechnologien) und Arbeitserfahrung.
Der Interaktionsprozeß zwischen Mensch und Computer ist situationsabhängig.
Daher nimmt die Erwartungshaltung eines Menschen wesentlichen Einfluß
auf die Art der Benutzung von Softwareapplikationen. Das Interaktionsverhalten
ist - je nach verfügbarem Zeitaufwand, Beweggründen und erwarteten
Ergebnissen - unterschiedlich. Die Benutzbarkeit (Usability) des Systems hängt
von Erstellern, Inhalten und Anwendern ab.
Computer (Digitale Technologien) 
Ein- und Ausgabegeräte sind die unmittelbaren Hardwareschnittstellen,
die den Benutzern Wege zur Verfügung stellen, analoge Aktionen (wie z.
B. Handbewegungen oder gesprochene Sprache) in digitale Steuerungsanweisungen
umzusetzen. Die Palette an entsprechenden Werkzeugen ist groß: So zählen
Tastaturen und Computermäuse ebenso zu Eingabegeräten wie Werkzeuge
zur Sprach- und Handschrifterkennung oder spezielle Schnittstellen, die auf
Besonderheiten der menschlichen Physiognomie reagieren. Ausgabegeräte präsentieren
visuelle, akustische bzw. teilweise auch kinästhetische Sinneseindrücke.
CRT-Monitore, Touch Screens, VR-Helme, Musik- und Sprachausgabegeräte seien
hier nur beispielhaft genannt.
Douglas Engelbart stellte im Jahr 1969 sein Konzept des "bit mapping"
vor. Er betrachtete den Bildschirm als zweidimensionaler Raum für die Darstellung
von Daten. Diese Fläche ergab für ihn ein gespiegeltes Bild der Elektronen,
die durch den Mikroprozessor jagen. Eine direkte Manipulation dieses Bildes
war durch Klicken auf entsprechende Symbole mittels des Prototypen einer Maus
möglich, welcher die taktile Unmittelbarkeit der Interaktion zwischen Mensch
und Maschine herstellte. (vgl. Johnson 1997, S. 30f.)
Softwarearchitekturen (Benutzeroberflächen, Dialogtechniken): Benutzeroberflächen
unterscheiden sich nach der Art und Qualität ihrer Aufbereitung. Ihre konkrete
Gestaltung ist von den verfügbaren Ein- und Ausgabegeräten gleichermaßen
abhängig wie von ihrem Nutzungskontext. Dialoge können verschiedenen
Zwecken dienen. Die Dialoggestaltung eines datenbankbasierten Expertensystems
wird anders aussehen als die eines Computerspieles. Eingabewerte können
standardisiert und diskret sein (z. B. numerische Werte für die Steuerung
von Prozessen) oder nicht-standardisiert und unscharf wie z. B. Suchabfragen
in natürlicher Sprache bei der Informationsrecherche. Ähnlich verhält
es sich mit jenen Informationen, die nach Analyse von Datenbeständen (Data
Mining) und Abfrage von Systemzuständen ermittelt werden. Bestätigungsdialogen
stehen Visualisierungen komplexer Datenbestände gegenüber.
Interaktion 
Interaktionen mit dem Computer sind speziell mediierte Handlungen. (...) Interaktion ist nicht nur durch die technische Dimension des Designs, sondern auch durch die Dimensionen des Inhalts definiert. (Schulmeister 1997, 45ff.)
Die Sinneserfahrungen des Menschen erfolgen über mehrere Kanäle (Multimodalität): Sehsinn, Hörsinn und Tastsinn. Ein Medium wiederum kann verschiedene Sinne ansprechen (Multicodalität bzw. Medialität). Das Medium Buch hat etwa visuelle und haptische Qualität, während der Film beispielsweise mit optischen und akustischen Reizen arbeitet.
Im menschlichen Kurzzeitgedächtnis ist die Speicherung und Verfügbarkeit einer begrenzten Menge von Informationen möglich. Die Zugriffszeit beträgt dabei meist einige Sekundenbruchteile, erfaßte Inhalte werden für rund ein bis zwei Sekunden behalten. Ungefähr sieben Einheiten (Begriffe oder Objekte) sind parallel unterscheidbar und kurzfristig speicherbar. Auf Inhalte im Kurzzeitgedächtnis kann direkt zugegriffen werden, seine Funktion ist jedoch von der aktuellen Aufmerksamkeit bestimmt.
Werden über die Sinnesorgane erfaßte Sachverhalte und Informationen
als relevant bewertet, so werden sie im Langzeitgedächtnis aufbewahrt und
mit bereits vorhandenem Wissen vernetzt. Erinnerung bedeutet in diesem Zusammenhang,
daß bestimmte Informationen bzw. Situationen bereits erfahren wurden und
daher eine kontextualisierte Beurteilung der erfaßten Sinneseindrücke
möglich ist. Assoziationen und Emotionen werden hervorgerufen, Verständnis
entsteht.
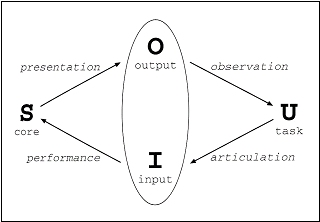
Abbildung 4: Interaktionsprozeß zwischen Mensch und Computer
Der Kommunikationsablauf zwischen Computer (System) und Benutzer (User) erfordert Dateneingabe (Input) und führt zu Datenausgabe (Output).
Dabei lassen sich auf Seite des Benutzers verschiedene Navigationsverhaltensweisen unterscheiden, die sowohl die Artikulation der Arbeitsaufgabe gegenüber dem System als auch die Reaktion bzw. Verarbeitung der vom System präsentierten Antwort betreffen.
Canter et al. (1985) unterscheidet verschiedene Herangehensweisen an Informationsbestände:
- Scanning - covering a large area without depth.
- Browsing - following a path until a goal is achieved.
- Searching - striving to find an explicit goal.
- Exploring - finding out the extent of the information given.
- Wandering - purposeless and unstructured "globe trotting".
Browsen bedeutet im ursprünglichen Sinn "Abgrasen eines Feldes" und ist heute im Zusammenhang mit dem Websurfen gebräuchlich. Es bezeichnet einen Navigationspfad, der sich durch das Verfolgen von Verweisen (Hyperlinks) ergibt.
Searching bezeichnet ein zielgerichtetes Auffinden von Information durch die Angabe von Suchtermini. Der Filter gegenüber nicht relevanten Informationen ist hoch, denn es soll ein konkretes Informationsbedürfnis abgedeckt werden. Fachdatenbanken und digitale Lexika ermöglichen beispielsweise detailliertes Suchen.
Systeme, die einen explorativen Ansatz unterstützen, zeichnen sich
dadurch aus, daß sie verschiedene Pfade und Touren durch die Inhalte zur
Verfügung stellen. Assistenten ("Wizards") geleiten den Benutzer
von verschiedenen Ausgangspunkten durch den Inhalt. Entsprechende Systeme weisen
einen besonders narrativen Charakter auf.
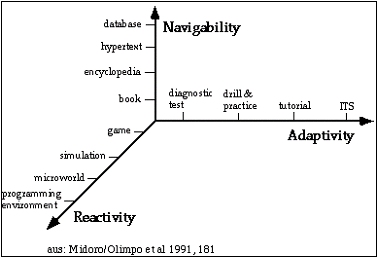
Abbildung 5: Klassifikation von Informationssystemen nach ihrer Interaktivität
Ziel der Gestaltung des Kommunikationsprozesses zwischen Mensch und Maschine ist es, der semantischen Dimension der Interaktion seitens des Benutzers eine entsprechende technische Syntax seitens der Software gegenüberzustellen. Interaktive und intuitive Benutzbarkeit einer Software läßt sich etwa durch die Anwendung der Kriterien Adaptivität, Reaktivität und Navigabilität beurteilen, wie die obenstehende Abbildung zeigt.
Die Adaptivität eines Informationssystems bezieht sich auf seine benutzerspezifische
Anpaßbarkeit. Reaktivität wiederum bezeichnet "dialogische"
Interaktion zwischen System und Benutzer. Die Navigabilität in einem System
steigt mit den angebotenen Hilfsmitteln und Pfaden durch die Inhalte.
Software-ergonomische Aspekte 
Die Norm "Ergonomische Anforderungen für Bürotätigkeiten mit Bildschirmgeräten" (ISO 9241) beschäftigt sich im Abschnitt "Grundsätze zur Dialoggestaltung" mit prinzipiellen Voraussetzungen, die das Benutzerinterface einer Software erfüllen muß, damit eine effektive Benutzerinteraktion stattfinden kann.
Aufgabenangemessenheit
In einem Interaktionsschritt sollen lediglich jene Inhalte präsentiert
werden, die unmittelbar der Aufgabenerfüllung dienen. Dazu zählen
etwa eine kontext-sensitive Hilfe, automatisierte Durchführung von Aktionen
nach erfolgter Benutzerabfrage oder die Vorgabe von Standardwerten.
Selbstbeschreibungsfähigkeit
Dialogfenster sollen für sich selbst sprechen, und - wenn möglich
- ohne zusätzliche unterweisende Erklärungen benutzbar sein. Die eingesetzten
Begriffe sollen mit dem Fachvokabular des Nutzers übereinstimmen. Erklärungen
sollen den Kenntnissen des Benutzers angepaßt sein.
Steuerbarkeit
Der Benutzer soll die Art und Geschwindigkeit des Programmablaufes selbständig
bestimmen können.
Erwartungskonformität
Sowohl Informationsdarstellung als auch Dialogverhalten des Systems sollen einheitlich
gestaltet sein. Der aktuelle Arbeits(fort)schritt soll stets erkennbar sein.
Fehlertoleranz
Fehlerhafte und unerwartete Benutzereingaben und Aktionen sollten verhindert
bzw. korrigiert werden.
Individualisierbarkeit
Benutzerspezifische Anpassungen der Benutzerschnittstelle wie Sprachwahl, Expertenmodus
und dergleichen ermöglichen eine personalisierte Nutzung der Software. Können
bestimmte Aktionen über verschiedene Dialogabläufe durchgeführt
werden, so nimmt die betreffende Software Rücksicht auf unterschiedliche
Benutzer.
Lernförderlichkeit
Erlaubt eine Anwendungssoftware intuitive Benutzung bzw. bietet sie entsprechende
Tutorien und Lernmodi an. Meist ist ein Experimentieren mit Beispieldokumenten
("Learning-by-doing") möglich, somit wird die Eingewöhnungszeit
verkürzt.
Informationsaufbereitung 
Modelle zur Vermittlung digitaler Inhalte 
Ausgehend von digitalen Technologien und deren Nutzern ergibt sich der Bedarf nach Modellen bzw. Werkzeugen, welche computergestützte Vermittlung und Aufnahmefähigkeit der Benutzer berücksichtigen und aufeinander abstimmen. Die nachstehend präsentierten Modelle verfolgen grundsätzlich getrennte Ziele, jedoch besteht gerade in ihrer Kombination die Chance, den Computer als didaktisches Werkzeug einzusetzen.
Multimedia
Die Kombination und gemeinsame Präsentation verschiedener Medien betrifft
sowohl ihre Multicodalität (textliche Informationen, Bildinhalte, Tonsequenzen)
als auch ihre Multimodalität (das Ansprechen verschiedener Sinne, vor allem
Sehen und Hören). Bei der Darstellung von Information muß folglich
ihre Art ebenso wie ihre adäquate Vermittlung berücksichtigt werden.
Hypertext
Die Verknüpfung verschiedener (textlicher) Inhalte mittels entsprechender
Verweise ("Links") führt zum Entstehen eines Informationsnetzwerkes.
Die daraus entstehende Struktur wird als Hypertext bezeichnet und ermöglicht
eine Informationsrezeption, die den angebotenen Referenzen folgt. Hypertexte
zeichnen sich idealerweise sowohl durch assoziative Querverbindungen zwischen
einzelnen Dokumenten als auch die Anwendung logischer Strukturierungswerkzeuge
innerhalb eines Dokumentes aus.
Hypertext should be seen as augmenting the existing techniques of structure and navigation (Kapitel und Verweisstrukturen in einem Buch, Anm. d. Verf.) not as superceding and replacing them. (...) The hypertext link is an online implementation of the cross-reference. (Hoffmann 2000)
Virtual Reality
VR umfaßt Technologien, die das menschliche Empfinden natürlicher Umwelt
digital nachzubilden versuchen. Vor allem die Wahrnehmung eines Raumes in optischer
wie auch akustischer Hinsicht stellt ein wesentliches Moment in der Erstellung
interaktiver multimedialer Umgebungen dar. Um ein Bewegen des Nutzers in VR-Räumen
zu ermöglichen, werden alternative Schnittstellen im Vergleich zu den herkömmlichen
Eingabegeräten wie Tastatur oder Maus eingesetzt. Wird das Sichtfeld des
Benutzers vollständig mit Daten der virtuellen Umgebung abgedeckt, spricht
man von immersiven Systemen. Dazu zählen im speziellen Systeme, die - in
Kombination von Head Mounted Devices mit einem Tracking-System, welches die Bewegungsabläufe
des Benutzers in digitale Impulse umsetzt - ein Begehen des visualisierten virtuellen
Informationsraumes erlauben.
Information Retrieval
Information Retrieval betrachtet Informationssysteme im Hinblick auf ihre Rolle
als elektronische Hilfsmittel, die den Wissenstransfer zwischen Produzenten
und Konsumenten (bzw. Nachfragenden) unterstützen. IR beschäftigt
sich vor allem mit der Problematik, die semantische Komponente des Wissens als
berechenbare Größe zu adressieren. Mittels der mathematischen Gewichtung
von wird versucht, die Relevanz- und Ähnlichkeiten von textlichen Inhalten
einer Dokumentenbasis in Relation zur gestellten Abfrage zu ermitteln.
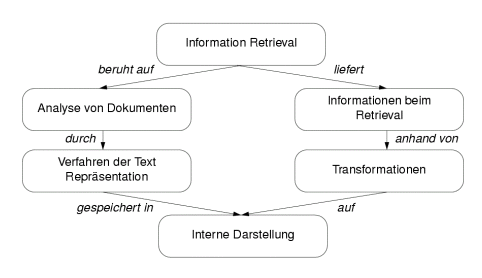
Abbildung 6: Grundmodell des Information Retrieval
Strukturierungswerkzeuge 
|
Modell |
Vorteil(e) |
Nachteil(e) |
|
Sequenz |
||
|
|
+ unterstützt narrativen Charakter |
- nur für Abbildung linearer Informationen geeignet |
|
Hierarchie |
||
|
|
+ für Abbildung detaillierter Informationsstrukturen geeignet |
- Information jeweils an einer fixen Stelle verankert |
|
Raster |
||
|
|
+ leichte Lokalisierbarkeit von Informationen |
- nur für entsprechend konsistente Strukturen geeignet |
|
Hypertext |
||
|
|
+ bildet komplexe, vernetzte Sachverhalte ab |
- unterschiedlicher Detaillierungsgrad der Dokumente wird nicht
berücksichtigt |
|
Virtual Reality |
||
|
|
+ kann reale Bezugspunkte virtuell nachbilden |
- VR-Technologie kann zu komplex bzw. zu "verspielt" eingesetzt werden |
|
XML |
||
|
<?xml version="1.0" ?> |
+ "naturgetreue" Abbildung von Objekten mit ihren Eigenschaften und Attributwerten |
- ein Abweichen eines XML-Dokumentes vom zugrundeliegenden Dokumenttyp ist nicht möglich (Gültigkeitsprüfung) |
|
(relationale) Datenbank |
||
|
|
+ liefert Antworten, die genau mit der Anfrage übereinstimmen |
- eher pragmatischer als intuitiver Zugang möglich |
Tabelle 2: Informationsstrukturierungswerkzeuge
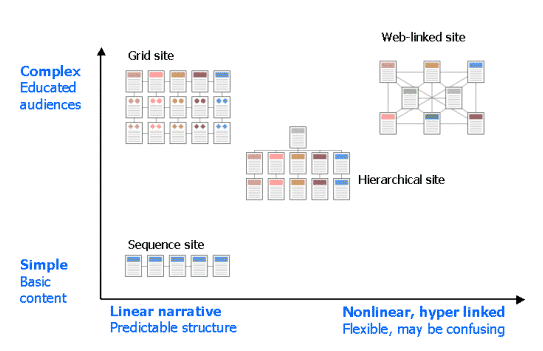
Abbildung 7: Informationsstrukturierungsschemata im Vergleich
Das obenstehende Diagramm zeigt die Strukturierungswerkzeuge Sequenz (Sequence), Hierarchie (Hierarchy), Raster (Grid) und Netzwerk (Web) im Vergleich. Die Komplexität sowie Linearität der Aufbereitung sind dargestellt.
Eine Sequenz folgt einem linearen, vorhersehbaren Schema. Gleiches gilt für
ein Raster, allerdings muß eine Matrixstruktur besonders klar definiert
sein. Hierarchien arbeiten mit Ober- und Unterbegriffen, demgegenüber sind
Netzwerke nicht nach fixen Regeln organisiert.
Informationscontainer der medien.matrix 
Rahmenbedingungen für die inhaltliche Aufbereitung
Die konzeptionelle Ausrichtung der medien.matrix orientierte sich am Wunsch,
ein die Ausstellung ergänzendes Informationssystem zu erstellen, in dem
den Museumsbesuchern in interaktiver Form virtuelle Szenarien zu ausgewählten
Themen der Mediengeschichte präsentiert werden. Es entstand die Idee, ein
System zu generieren, das verschiedene Ebenen zur Orientierung bzw. inhaltlichen
Vertiefung anbietet.
Lead- und Subtexte stellten als erfaßbare Informationseinheiten mit einer
Textlänge von in etwa 1.000 Zeichen den Ausgangspunkt für die weiteren
konzeptionellen Überlegungen dar. Durch die Vernetzung der einzelnen Textelemente
sollte eine Hypertext-Struktur entstehen, die es ermöglicht, die vielfältigen
Facetten der Mediengeschichte thematisch bzw. chronologisch zu lesen.
Einen Anknüpfungspunkt für die Inhaltsauswahl stellten die für die (reale) Ausstellung geplanten Themeninseln dar. Das Konzeptteam erarbeitete für die medien.matrix aus verschiedensten online- und offline-Quellen textliche Inhalte zu Themen der Informations- und Kommunikationsgeschichte.
Weiters ergab sich die Frage nach Quellen für Bild- und Tonmaterial, das
für die graphische Illustration bzw. auditive Untermalung der medien.matrix
Verwendung finden würde. Die Österreichische Nationalbibliothek, das
Filmarchiv Austria, die Österreichische Mediathek, das Heinz Nixdorf MuseumsForum
sowie zahlreiche Bildagenturen aus dem europäischen Raum erklärten
sich bereit, Quellenmaterial zur Verfügung zu stellen.
Vorliegende Strukturierung
Eine Bewertung der Inhaltscontainer der medien.matrix zeigt, daß im vorliegenden Fall - wie bei jedem anderen digitalen Informationssystem - zwischen Elementen, die der Orientierung dienen (Navigation) und solchen, die eine erklärende Funktion besitzen (Inhalte), unterschieden werden kann.
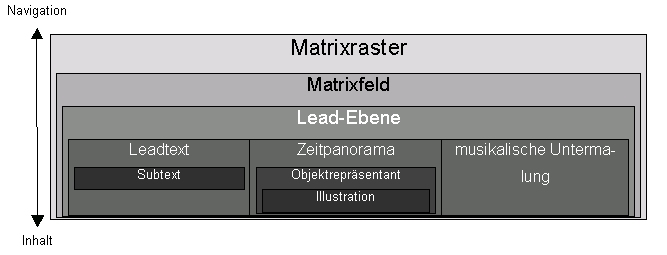
Abbildung 8: Informationscontainer der medien.matrix
Matrixraster
Die Aufgabe der Rasterstruktur liegt darin, die Strukturierung der Inhalte zur
Mediengeschichte nach Themenbereiche und Zeitzonen vorzunehmen. In der vorliegenden
Form bietet der Raster einen Gesamtüberblick und ermöglicht zugleich
einen direkten Einstieg zu den Inhaltselementen. Die Themenachse, welche die
genealogische Einteilung der Medien ermöglicht, generiert folgende Matrixspalten:
Linie (für Geometrie, Vermessung), Zahl, Liste (für Verwaltung), Schrift,
Bild (Speicherungsmedien) sowie Ton (für musikale und theatrale Aktivität),
Spiel, Forum, Post, Tele (als Verweise auf Übermittlungsmedien). Die Zeitachse
bildet die historischen Zeiträume ab: Antike, Mittelalter, Renaissance,
Barock, Aufklärung, Industrialisierung, Jahrhundertwende, 1. Weltkrieg,
Zwischenkriegszeit, 2. Weltkrieg, Nachkriegszeit, Computerära, Konvergenz.
Matrixfeld
Das einzelne Rasterelement dient als Rahmen für die Präsentation ihm
zugehöriger Inhalte. Es beinhaltet jene textlichen, graphischen und auditiven
Elemente, die einem Thema und einer Zeitzone zugeordnet sind.
Leadtext
Dieser vermittelt die sozialhistorische Rolle eines medienhistorischen Aspektes
in der jeweiligen Zeit. So referenziert der Leadtext zu "Linie/Antike"
etwa die Thematik der Landvermessung und Wegestreckenberechnung zur damaligen
Zeit. "Bild/Renaissance" bezieht sich im Gegensatz dazu auf die Rolle
der Naturbeobachtung, Kompositionstechniken und Proportionslehre um 1500. "Post/Konvergenz"
stellt den elektronischen Briefverkehr vor, wie wir ihn heute kennen und häufig
nutzen.
Subtext
Den hundertdreißig Leadtexten der Matrixstruktur sind jeweils drei Subtexte
zugeordnet, welche einzelne in den Leadtexten angerissene Aspekte näher
erläutern. Sie dienen vornehmlich dazu, historische Hintergründe bzw.
technische Funktionsprinzipien im Ansatz zu beschreiben.
Zeitpanorama
Es stellt ein virtuelles Abbild der Zeit dar, welches sich aus einer historischen
Umgebung zusammensetzt, die ein entsprechendes Stimmungsbild ergeben soll. So
stellt das Panorama zu "Ton/Antike" ein griechisches Amphitheater
dar. Diese Umgebung soll die räumlichen und akustischen Dimensionen des
antiken steinernen Klangraums erfahrbar machen.
Objektrepräsentant
Im Bühnenbereich des eben als Beispiel angesprochenen Amphitheaters sind
verschiedene Objektrepräsentanten angesiedelt, die auf entsprechende reale
Artefakte verweisen. Theatermasken, eine Lyra sowie ein Chor vermitteln, welche
Rolle dem antiken Schauspiel zukommt.
Illustration
Hinter den einzelnen Repräsentanten verbergen sich illustrative Elemente,
wie z. B. interaktive Applikationen, zwei- bzw. dreidimensionale Animationen,
Videosequenzen, Bildergalerien oder Musik- und Sprachsequenzen.
Musikalische Untermalung
Im Gesamtkonzept der medien.matrix ist - als Ergänzung zur graphischen
Einbettung der Inhalte mittels des Zeitpanoramas - auch an ein entsprechendes
musikalisches Stimmungsbild gedacht.
Graphische Gestaltung 
Indem er sich seine Geschichten als Bauwerke vorstellte, zapfte Simonides dieses Potential zu räumlicher Gedächtnishilfe an. Jeder Raum löste ein anderes Ereignis in der Geschichte aus, eine neue Wendung in der Argumentation. Wenn Simonides mehr Adjektive oder eine stilistische Ausschmückung brauchte, konnte er die Räume mit weiteren Details ausstatten. Die Geschichte zu erzählen war für ihn dann so, als schlenderte er durch die Räume eines Palasts. (Johnson 1997, S. 22)
Cyberspace. A consensual hallucination experienced daily by billions of legitimate operators, in every nation, by children being taught mathematical concepts . . . A graphic representation of data abstracted from the banks of every computer in the human system. Unthinkable complexity. Lines of light in the nonspace of the mind, clusters and constellations of data. Like city lights receding. . . . (Gibson 1984, S. 51)
Visualisierter Informationsraum 
Bildergalerie
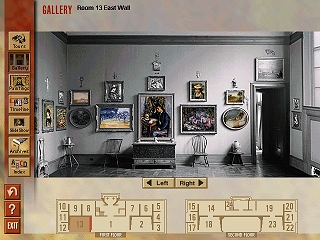
Abbildung 9: Gallery - Room 13 East Wall
Eine Abbildung der realen Präsentationsumgebung erzeugt virtuelle Räume. Die digitale Umsetzung der physischen Räume erfolgt in ästhetischer und funktionaler Hinsicht. Bei der Auswahl eines Gemäldes wird es vergrößert dargestellt und Informationen zum Werk angezeigt. Als Navigationswerkzeug durch die Galerie dienen Richtungspfeile sowie Türen zwischen den einzelnen Räumen. Der Lageplan erlaubt eine sprunghafte Bewegung durch das Haus.
Web Forager
Consider a future device for individual use, which is a sort of mechanized private file and library. It needs a name, and to coin one at random, "memex" will do. A memex is a device in which an individual stores all his books, records and communications, and which is mechanized so that it may be consulted with exceeding speed and flexibility. It is an enlarged intimate supplement to his memory. (Bush 1945)
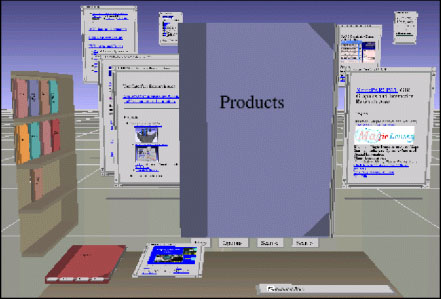
Abbildung 10: Web Forager
Der abgebildete virtuelle Informationsraum ("WebForager") erinnert an "Memex" und beinhaltet elektronische Dokumente. Recherchierte Webseiten werden auf einem Schreibtisch zu Büchern ("WebBooks") zusammengefaßt und anschließend in einem Regal verwahrt. Für alle Dokumente, die sich nicht im Bücherkasten befinden, werden verschiedene Navigationsfunktionen angeboten. Auffällig ist, daß das System für elektronische Dokumente ein vom Medium Buch "entlehntes" Rezeptionsverhalten nachbildet. Das am Xerox Palo Alto Research Center entwickelte System, läßt Informationsbestände durchblättern oder in ihrer Gesamtheit mittels einer "document lens" betrachten.
 Abbildung 11: Durchblättern eines "WebBooks" |
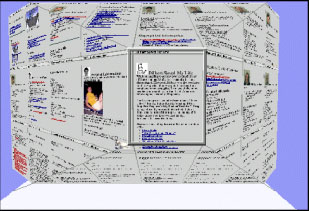 Abbildung 12: Suche mit der "DocumentLens" |
Informationscluster
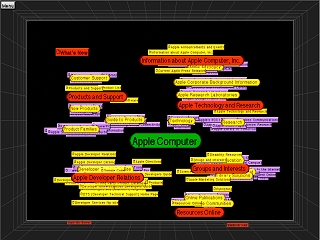
Abbildung 13: Hot Sauce
Die Graphik stellt eine Variante einer assoziativen Informationspräsentation
dar. In dem abgebildeten Informationscluster (Mindmap) dienen Begriffe als Referenzen
zu elektronischen Dokumenten. Die gegenseitigen "Verwandtschaften"
der einzelnen Bezeichnungen werden in zweierlei Hinsicht vermittelt: Durch unterschiedliche
Farbgebung wird eine hierarchische Abstufung erkennbar, die Anordnung der einzelnen
Elemente verweist auf assoziative Zusammenhänge.
Fraktal
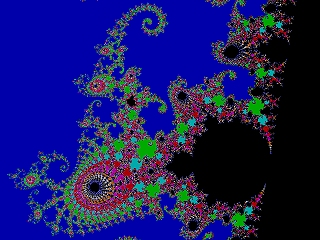
Abbildung 14: Ausschnitt aus einer Mandelbrot-Menge
Die fraktale Geometrie, Geometrie des Chaos, beschreibt lokal "rauhe"
und dadurch nicht differenzierbare Objekte. Die meisten Fraktale besitzen eine
sogenannte Selbstähnlichkeit; darunter versteht man die Invarianz gegenüber
zentrischen Streckungen.
Zeitleiste
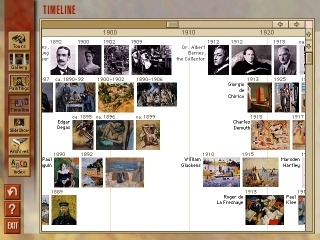
Abbildung 15: Timeline
Ereignisse, Menschen, Werke einer Epoche werden entsprechend ihrer Chronologie
wiedergegeben. Durch diese unmittelbar nachvollziehbare Inhaltsstrukturierung
ist eine rasche Orientierung gegeben. Historische Parallelitäten können
unmittelbar aufgelöst werden.
Geographisches Informationssystem
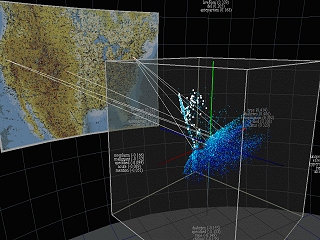
Abbildung 16: Starlight
Bei der vorliegenden Darstellung handelt es sich um ein geographisches Informationssystem.
Es wird mit Ebenen verschiedenen Abstraktionsgrades gearbeitet, die teilweise
aus der Digitalisierung realer Gegebenheiten stammen und teilweise computergeneriert
sind. Reale topographische Vermessungsdaten werden durch Zusatzinformationen
ergänzt. So sind verschiedenartige Simulationen und mathematische Berechnungen
möglich.
Baumstruktur
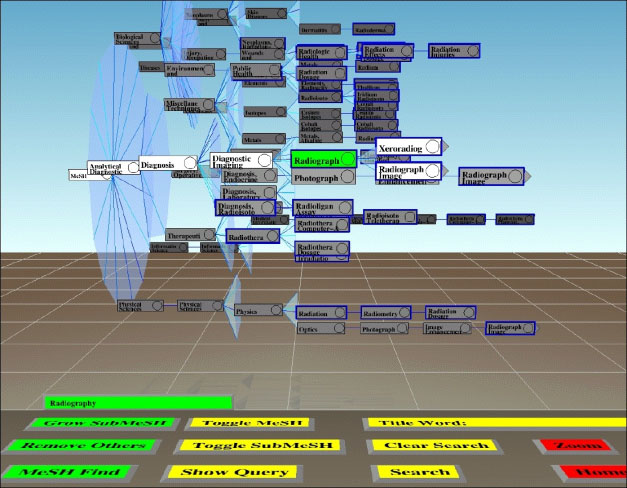
Abbildung 17: Cat-a-Cone: Visualisierung einer Suche in der Datenbank "Medline"
Cone Trees sind Werkzeuge, um Informationshierarchien dreidimensional zu präsentieren.
Gängige Hierarchiebäume tendieren dazu, wesentlich breiter als höher zu sein. Ausdruck dieses Mißverhältnisses ist das Abbildungsverhältnis (Breite vs. Tiefe). Bei zweidimensionalen Hierarchiedarstellungen wächst das Abbildungsverhältnis selbst bei kleinen Knotengraden (zwei oder drei) schnell an (fast exponentielles Wachstum). (Wiechert 1998, S. 56)
Der dargestellte Cam Tree ist eine horizontale Ausrichtung eines Cone Trees und erlaubt, breitere Hierarchien handhabbarer zu machen.
Zu den vorgeschlagenen Erweiterungen der allgemeinen Cone-Tree-Technik gehören auch die semantischen Filter. Diese ermöglichen es, mit Hilfe von Knotenattributen und veränderbaren Grenzwerten, die unter Umständen riesigen Knotenmengen entsprechend den Intentionen des Benutzers auf die wesentlichen Elemente zu reduzieren. (Wiechert 1998, S. 58)
Interaktive Benutzeroberfläche

Abbildung 18: "Kugel-Designer"
Eine virtuelle Arbeitsoberfläche läßt den Entwurf von Kugeln
zu, die mit unterschiedlichen Oberflächentexturen und -eigenschaften ausstattbar
sind. Die Intuitivität des Gestaltungsprozesses steht im Vordergrund.
Brain Mapping
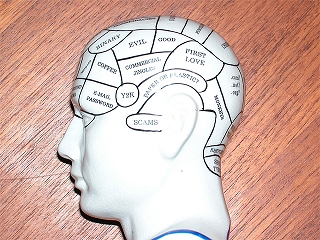
Abbildung 19: "The Human Mind"
Eine Kategorisierung des menschlichen Gehirns nach Interessensgebieten. Jetzt haben wir es schwarz auf weiß, welche Themen angeblich das Leben eines Informationsmanagers ausmachen. Hoffentlich haben die Informationsarchitekten des 21. Jahrhunderts eine breitere Perspektive!
Skizzierte Entwürfe der medien.matrix

|
Matrixraster |
|
|
|
Die schematische Darstellung des Matrixrasters verdeutlicht die zweidimensionale Inhaltsstrukturierung. Die horizontale Themenachse präsentiert Beschriftungen wie Linie, Zahl, Liste, usw. Vertikal angeordnet sind die Zeitzonen Antike bis Konvergenz. Die Matrixinhalte werden segmentweise - der Verortung der Informationsterminals in der Ausstellung entsprechend - zugänglich gemacht. Die Hervorhebung eines Teilbereiches der Matrix erfolgt mittels eines Lichtkegels. |
|
Navigationswerkzeuge |
|
|
|
Um die Navigation in der Matrixstruktur zu ermöglichen, werden entsprechende Werkzeuge angeboten. Ein verkleinertes Abbild des Rasters soll einen Gesamtüberblick gewährleisten, sobald ein konkretes Matrixfeld aktiviert ist. In der Mitte der Navigationsleiste befinden sich Steuerungsmöglichkeiten, um zu den thematisch bzw. zeitlich angrenzenden Matrixfeldern zu gelangen. |
|
Matrixfeld |
|
|
|
Auf der Ebene eines einzelnen Matrixfelds ist die schematische Anwendung der Informationscontainer Leadtext, Panorama, erkennbar. Auffällig ist eine Zweiteilung der Inhaltspräsentation. Die textlich aufbereitete Ebene (mit Lead- und Subtexten) wird in Form eines halbtransparenten Textpanels dargestellt. Auf der rechten Seite werden, komplementär dazu, die graphischen bzw. auditiven Bestandteile (über entsprechende Repräsentanten) zugänglich gemacht. |
|
Beispiel »Ton/Antike« |
|
|
|
Das skizzierte Beispiel-Szenario soll den konsistenten Gesamteindruck widerspiegeln, den ein gewähltes Matrixfeld vermitteln soll. Die Ebene der Texte spricht in schriftlicher Form einige wesentliche historische Aspekte des Themas an. Die theoretisch dargestellten Facetten werden mittels eines in das Zeitpanorama eingebetteten Objektensembles illustriert. So ist für die Benutzer sowohl ein eher rationaler, informativer als auch ein emotional-explorativer Einstieg in die Inhalte möglich. |
Graphische Umsetzung der medien.matrix

|
Matrixraster |
|
|
|
Die Visualisierung des Rasters betont durch ihren Farbverlauf von Orange (Speichermedien) nach Gelb (Übermittlungsmedien) den Zusammenhang und die Parallelitäten medialer Phänomene. Die beiden Achsen sind beidseitig horizontal (Thema) und vertikal (Zeit) angeordnet, generieren den Raster und ermöglichen eine eindeutige Lokalisierung eines Matrixfeldes, das als Überschneidungsbereich zwischen einer Themenspalte und einer Zeitzeile (Panorama!) entsteht. |
|
Navigationswerkzeuge |
|
|
|
Die Navigationspfeile nach links und rechts ermöglichen das Surfen innerhalb einer Zeit (z. B. Antike). Pfeile nach oben bzw. unten erlauben das Rezipieren von Inhalten eines Themas (z. B. Ton). Auf der rechten Seite ist ein verkleinerter Plan der Matrix erkennbar, der eine Orientierung in der Struktur ermöglicht. |
|
Matrixfeld |
|
|
|
Das Layout des Matrixfeldes wurde im konkreten Fall für eine Bildschirmauflösung von 1024 x 768 Punkten umgesetzt. Zwei Fünftel der Bildschirmbreite stehen für die Textebene zur Verfügung, drei Fünftel für das Objektensemble. Das Zeitpanorama bildet - formatfüllend - den Hintergrund. Circa 20% der Bildschirmfläche stehen - vom unteren Rand gerechnet - für die Navigationsleiste zur Verfügung. |
|
Beispiel »Ton/Antike« |
|
|
|
Das Beispiel "Ton/Antike" wurde - der Vorlage entsprechend umgesetzt. Der Leadtext trägt den Titel "Kultur des Gesprochenen" erläutert die Welt des antiken Schauspiels. Subtexte mit den Titeln "Musik und Kult", "Rhapsoden" sowie "Griechisches und römisches Theater" schildern interessante Details. Ein griechisches Amphitheater erfüllt die Funktion des Panoramas, das Objektensemble besteht aus Theatermasken und einer Lyra. |
Softwaretechnischer Lösungsansatz 
Auswahl geeigneter Technologien 
Präsentationsumgebung
Sollen Inhalte für die Anzeige in einem Webbrowser aufbereitet werden, so ergeben sich Anforderungen an die Wahl der Präsentationsumgebung sowie der eingesetzten Datenformate für Bild- und Ton. Zwei grundlegend verschiedene Ansätze stehen zur Auswahl: Eine HTML-Lösung mit Cascading Style Sheets hat den Vorzug einer raschen Erstellung und einer vollständig automatisierten Generierung. Plugin-Lösungen - multimediale Umgebungen, die auf proprietäre Zusatztechnologien angewiesen sind - bieten größere gestalterische Freiheit, verlangen aber technische Spezialkenntnisse und sind aufwendig zu konzipieren.
Datenformate für Bild und Ton
Die medien.matrix enthält als multimedial vernetztes Informationssystem über die Mediengeschichte große Datenbestände unterschiedlichen Charakters. Text, Audio und Bild/Video sind eingebunden. Daher galt es, eine Typologie der auftretenden Inhalte im Hinblick auf verfügbare Technologien zu überlegen.
Panoramen
Die Idee, innerhalb einer Zeitzone der Matrixstruktur ein historisches Stimmungsbild
zu präsentieren, läßt an 360°-Panoramen denken, die ein
räumliches Gesamterlebnis bieten. Programme zu deren Erstellung sind etwa
PhotoVista oder Quicktime VR.
Vektorgraphiken bzw. Animationen
Verschiedene Technologien zum Entwurf von Vektorgraphiken stehen zur Auswahl,
die jeweils unterschiedliche Ziele verfolgen und dementsprechende Anwendungsgebiete
definieren.
Shockwave (Flash bzw. Director) stellt eine eigene Präsentationsumgebung bzw. Authoring-System für multimediale Projekte dar. Die Zeichenfläche kann über verschiedene Ebenen parallel genutzt werden. Einzelne Themen lassen sich durch die Verwendung von Szenen abgrenzen.
In Scalable Vector Graphics (ein XML-Dokumenttyp) können zweidimensionale Vektorgraphiken definiert werden. Drei Typen von graphischen Objekten werden unterstützt: Polygone (Pfade, die sich aus Linien und Kurven zusammensetzen), Bilder und Textelemente. Gruppierung, Formatierung und Transformierung von Objekten ist möglich.
Virtual Reality Modeling Language ist eine Beschreibungssprache für dreidimensionale Welten und virtuelle Mehrbenutzerumgebungen. VRML bietet in seiner aktuellen Version aus dem Jahr 1997 zusätzlich zur Modellierung von Objekten Funktionen für Animation und Interaktion, Raumklang-Wiedergabe und verfügt weiters über eine Schnittstelle zu JavaScript und Java. Mit X3D wurde der Versuch gestartet, die Sprachsyntax von VRML in eine XML-DTD umzuwandeln.
Videos
Filmsequenzen eignen sich dazu, narrative Bildinhalte zu transportieren.
An Datenformaten bieten sich Apple Quicktime sowie Real Video an. Quicktime
liefert qualitativ bessere Bilddaten als Real Video, welches sich aber aufgrund
seiner hohen Datenkompression für Webvideo eignet.
Audio
Streaming und Kompressionstechnologien ermöglichen den Transport von Audiodaten
über Netzwerke unterschiedlicher Bandbreite. Zur Übertragung von Sprache
und Musiksequenzen haben sich die Formate MPEG Audio Layer 3 (MP3) sowie Real
Audio durchgesetzt. MP3-codiertes Audiomaterial bietet den Vorteil einer nahezu
verlustfreien Reduktion der Datenmenge auf etwa ein Zehntel der Originalgröße.
Real Audio-Daten werden stärker komprimiert und eignen sich vorwiegend
für live-Übertragungen, die auf Websites im Internet angeboten werden,
bei denen nicht auf hohe Wiedergabequalität wertgelegt wird.
Konkrete Implementierung 
Ausgangspunkt
Zielsetzung der Konzeption des Prototypen der medien.matrix war es, eine funktional vollständige Vorschau auf das Endprodukt zu ermöglichen. Bevor jedoch mit der Programmierung der einzelnen Teilkomponenten begonnen werden konnte, mußte überlegt werden, welche Technologien für das System in Betracht kämen.
Der gesamte digitale Ausstellungsteil der medien.welten soll unterschiedliche interaktive Stationen umfassen, die miteinander über ein entsprechendes Netzwerk verbunden sind. Daher wurde von Anfang an eine netzwerkfähige, erweiterbare Softwarelösung angestrebt, die auf Internettechnologien basiert. Die Inhalte sollten über dasselbe System eingegeben, aktualisiert und präsentiert werden. Um eine entsprechende Handhabung gewährleisten zu können, wurde eine Lösung gefunden, die unterschiedliche Präsentationsformen vereint und von einer dynamischen Datenquelle generiert wird.
Dynamische Datenbasis
Wie bereits im Kapitel Inhaltsstrukturierung ausgeführt, lassen sich Struktureinheiten wie etwa Matrixstruktur oder Matrixfeld mittels entsprechend verknüpfter Tabellen abbilden. Einerseits erfolgt damit eine automatisierte Generierung der graphischen Darstellung des Rasters, andererseits ist eine direkte Adressierung eines Matrixfeldes ermöglicht. Daher wurde eine relationale Datenbank - im konkreten Fall handelte es sich um das frei verfügbare Softwareprodukt MySQL - als Steuerungsinstrument für die Rasterstruktur ausgewählt.
Folgende Tabellen bilden die Rasterstruktur ab und ermöglichen die Navigation
auf der Matrix zu den Inhaltsfeldern.
| Matrixstruktur | bildet die Gesamtstruktur ab |
| Matrixachse | enthält die Themen- und Zeitachse |
| Matrixkoordinate | enthält die Achsenabschnittsbeschriftungen und legt deren Reihenfolge fest |
| Matrixfeld | ist durch eine Themen- und eine Zeitkoordinate definiert und enthält die Referenz auf die XML-Beschreibung des Matrixfeldes |
Weiters galt es zu überlegen, wie man die Informationscontainer innerhalb eines Matrixfeldes abbilden könnte. Hier erwies sich XML als flexibles Strukturierungswerkzeug. Nachdem eine Dokumenttypdefinition für ein Matrixfeld durchgeführt wurde, ergab sich ein Schema, welches die Daten in einer maschinell und menschlich direkt verarbeitbaren logischen Struktur wiedergibt.
Die Grobstruktur eines Matrixfeldes setzt sich etwa aus folgenden Tags zusammen
und bestimmt das Aussehen eines Raumes in Bezug auf seine logischen Einheiten
(die Informationscontainer) sowie deren Positionierung im Seitenlayout.
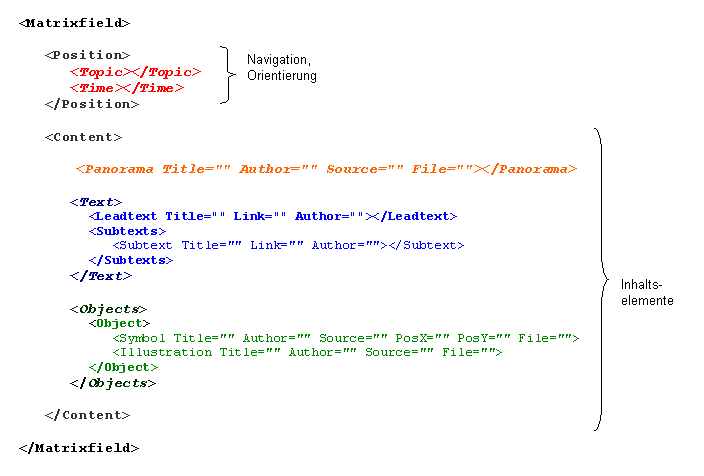
Abbildung 20: XML-Strukturierungsschema für ein Matrixfeld
Datenaufbereitung mit PHP, VRML und HTML 
Da sich eine händische Ausprogrammierung der VRML-Einstiegsmaske als unpraktikabel erwies, wurde mittels PHP eine Lösung zur automatischen Generierung der Einstiegsmaske in die Matrixstruktur erstellt. Die einzelnen Matrixfelder des Prototypen stehen als HTML-Seiten zur Verfügung, die Cascading Style Sheets verwenden und ebenfalls mittels PHP erzeugt werden.
PHP wurde 1994 von Rasmus Lerdorf konzipiert. Es handelt sich um eine in HTML eingebettete "open source"-Skriptsprache zur Entwicklung dynamischer Webseiten. Charakteristika von PHP sind etwa kurze Entwicklungszeit und plattformübergreifende Kompatibilität, die durch eine offene Programmierschnittstelle (API) und konstante Aktualisierungen erreicht werden.
VRML ist eine Beschreibungssprache für dreidimensionale Umgebungen ("virtuelle Welten") im World Wide Web. VRML, das 1994 entstand, baut auf einem 3D-Standard der Firma Silicon Graphics auf. Um VRML-Welten darstellen zu können, ist ein Browser-Plugin notwendig, das verschiedene Navigationsfunktionen für die Bewegung in der dreidimensionalen Umgebung bietet. Der VRML-Quellcode ist Plain-Text, daher plattformunabhängig und entweder manuell bzw. mittels spezieller Authoring-Werkzeuge produzierbar.
HTML steht für Hypertext Markup Language und existiert seit 1992 als Beschreibungssprache für Textdokumente, die im World Wide Web angeboten werden.
Unter einer "linuga franca" versteht man eine "Brot- und Butter-Sprache", eine Sprache, die jeder kennt, jeder spricht, jeder leicht erlernen kann und jeder braucht. HTML ist eine solche Sprache. Vom Web-Gründer Tim Berners-Lee entwickelt, wurde HTML im Zuge des Web-Booms zum erfolgreichsten und verbreitetsten Dateiformat der Welt. (Münz 2001)
Evaluation 
Testdaten 
Um die Vermittlungsleistung des vorliegenden Systems testen zu können, war es notwendig, die vorhandenen Matrixtexte durch entsprechendes Bild- und Tonmaterial zu illustrieren. Es wurden insgesamt dreißig Matrixfelder (die Zeitzonen Antike, Mittelalter und Renaissance) graphisch gestaltet.
Im Laufe der Recherche wurde offensichtlich, daß ein geeignetes Hilfsmittel
vonnöten war, um die Materialsuche, die offline und online-Quellen gleichermaßen
verwendete, gezielt durchführen zu können. Für den Prototyp wurde
ein Modell überlegt, das die schrittweise Ideenfindung für die Gestaltung
der Panoramen und Objektensembles ausgehend von den Texten gestattete. Die folgende
Tabelle zeigte sich als praktikables Konkretisierungshilfsmittel.
| Thema/Zeit | |
| Ziel | Was soll erreicht werden? |
| Methode | Welche Vorgangsweisen bieten sich an? |
| Motive | Welche medialen Instrumentarien werden verwendet? |
| konkrete Abbildungen | Welche Objektrepräsentanten sind denkbar? |
| Panorama | Wie erfolgt die historische Einbettung? |
| Anmerkungen | Welche zusätzlichen Ideen und offenen Fragen gibt es? |
Tabelle 6: Konkretisierungsinstrument für Illustrationsskizzen
Für die Illustration des Matrixfeldes "Linie/Antike" ergab sich folgendes Gestaltungspotential:
| Linie/Antike | |
| Ziel | Zuteilung von Grund und Boden, Navigation auf Land und See, Aufbau von Verkehrsnetzen zum Handel und zur staatlichen Verwaltung |
| Methode | Landvermessung und Abbildung nach geometrischen Kriterien, darauf aufbauend Straßen- und Wegebau, Sternenbeobachtung |
| Motive | schematisierte Pläne mit beschreibenden Texten, Wegenetze, Vermessungsinstrumente |
| konkrete Abbildungen | befestigte römische Fernstraße, Winkelmeßgeräte (Groma, Astrolabium, Quadrant) |
| Panorama | Tabula Peutingeriana |
Tabelle 7: Beispiel einer Definition einer Matrixfeld-Illustration
Nutzen einer Bewertung 
Zielsetzung
Die Evaluation von Museumsinformationssystemen hilft, das Angebot an interaktiven Inhalten zu verbessern und weiterzuentwickeln. Die Analyse der Ergebnisse soll Einblick geben, ob durch den Einsatz von Multimedia die Vermittlungsaufgabe einer Ausstellung unterstützt wird. Benutzerumfragen und Softwaretests stellen eine Chance dar, das (digitale) Ausstellungsangebot besuchergerecht zu gestalten und sind nicht als Aktivitäten zur Schönfärberei mit statistischem Deckmantel zu verstehen.
An den Museen liegt es, ihrer öffentlichen Bildungsaufgabe gemäß,
Ausstellungen zu gestalten, die Interesse wecken, auf gesellschaftlich relevante
Themen Bezug nehmen, dem Wissenserwerb und der Weiterbildung zu dienen. Die
folgenden Fragen könnten etwa im Zentrum einer Bewertung des digitalen
Ausstellungsprogrammes stehen:
- Wie fügt sich das digitale Angebot in die Ausstellung bzw. den Gesamtkontext
des Museums ein?
- Wie wird die digitale Applikation von den Besuchern wahrgenommen?
- Welchen Nutzen bietet das Programm?
Zu beachten gilt, unabhängig von der gewählten Testmethode, daß
erst eine Zufallsstichprobe (random sampling), also im konkreten Fall die Auswahl
einer heterogenen Gruppe von Testpersonen bzw. Interviewpartnern, einen einigermaßen
zuverlässigen Rückschluß auf die Meinung und Reaktion aller
Besucher erlaubt.
Methoden
Evaluation umfaßt die Aktivitäten der quantitativen und qualitativen
Messung, Aufzeichnung und Analyse.
It is best to employ a combination of methodologies to measure the effectiveness of multimedia programs at various levels, relating quantitative with qualitative results. It is usually necessary to combine several methods in order to have a better chance to verify and combine data. (ICOM 1996)
Front-End-Methoden: Vorerhebungen ermöglichen zum Zeitpunkt der Planung einer Ausstellung, die Interessenslage für das jeweilige Thema zu ermitteln und die Eignung für den Einsatz computerbasierter Vermittlung festzustellen.
Formative Evaluation dient der Verfeinerung und Anpassung der Applikation, stellt die intuitive Gestaltung des Programminterface sicher, gibt Hinweise bezüglich der Auflösbarkeit der inhaltlichen Strukturierung und hilft, eventuelle Programmierfehler (Bugs) zu entdecken. Wird eine formative Evaluation in Entwurfsphase der digitalen Lösung durchgeführt, kann die Entwicklung des Endprodukts positiv beeinflußt werden. (z. B. die vorliegende Evaluation)
Summative Evaluierung (zusammenfassendes Feedback): Die tatsächliche Frequentierung der interaktiven Stationen kann meist erst im Detail beobachtet werden, wenn diese in den vollständigen Kontext der Ausstellung (Besucher und reale Artefakte) eingebettet sind.
Beobachtung: Das Verhalten des Nutzers wird mittels einer formalen Datensammlung in Form einer Checkliste mit Anmerkungen aufgezeichnet. Alternativ dazu bietet sich eine Videoaufzeichnung an, um das Benutzerverhalten im Detail zu studieren.
Interviews sind freie Einzel- oder Gruppendiskussionen, die sich teilweise an einem Fragenkatalog orientieren. Ein hoher Zeitaufwand ist erforderlich, jedoch werden qualitative Daten erhoben. Die Datenerfassung und -auswertung kann durch einen Audiomitschnitt oder ein Gesprächsprotokoll erfolgen.
User Interaction Logging ist eine verläßliche Methode, um Benutzerverhalten zu studieren. Zeitweise gestaltet es sich schwierig, zwischen den einzelnen Nutzern zu unterscheiden. Testserien werden meist in künstlichen Laborumgebungen durchgeführt, daher ist oftmals kein direkter Rückschluß auf reale Benutzungssituation möglich.
Fragebögen ermitteln Feedback in elektronsicher oder handschriftlicher
Form. Meist werden statistische Kriterien über die Nutzer erfaßt.
Akzeptanztest 
Leitfragen
Der Akzeptanztest der medien.matrix wurde konzipiert, um Aufschluß über die zu erwartende Nutzung zu erhalten. Die Bewertung des Systems nach software-ergonomischer Benutzbarkeit (Usability), Erfüllung der Vermittlungsaufgabe sowie Attraktivität für den Benutzer bildete den Rahmen der Evaluation. Die Ermittlung des durchschnittlichen Navigationsverhaltens im System stand im Zentrum der Betrachtung. Es sollte festgestellt werden, ob eine Rezeptionspräferenz der Matrixstruktur nach Themen- bzw. Zeitachse vorliegt. Außerdem sollte die Auswertung einen Hinweis auf die generelle Nutzungsweise geben und zeigen, ob diese linear bzw. sprunghaft erfolgt.
Testkriterien
Im Artikel "Multimedia in Museums" (ICOM 1996) werden beispielhafte Evaluationskriterien genannt, die unterschiedlichen Kategorien zugeordnet sind und in die Ausarbeitung der angewandten Meßinstrumente einflossen:
- User Interface/ Presentation
- Structure/ Navigation
- Programming
- Content
- Integration with Exhibition/Museum
- Distribution
- Overall Impressions
Leitfadeninterview und User Interaction Logging wurden als methodische Instrumente gewählt, um die medien.matrix auf ihre Akzeptanz unter potentiellen Ausstellungsbesuchern zu testen. Die wesentlichen Testkriterien sind auf den folgenden beiden Seiten angeführt.
Leitfadeninterview
Nachstehend sind die Fragen des Leitfadeninterviews angeführt, die als Grundlage für den Benutzertest herangezogen wurden.
- Wie groß ist Ihr Interesse an der Mediengeschichte?
Ermittlung der Neugierde der Testperson, sich mit entsprechenden Inhalten auseinanderzusetzen.
- Gibt es ein Thema, das Sie im Bereich der Mediengeschichte besonders interessiert?
(Wenn ja, wo würden Sie hinklicken, um dieses Thema zu finden?)
Die Nennung eines konkreten Themenbereiches läßt beschränkt Rückschlüsse auf das Vorwissen der Testperson zu.
- Ich bitte Sie jetzt, das System auszuprobieren. Wenn Sie Hilfe brauchen
oder Fragen haben, dann fragen Sie mich einfach. Ich bin gerne bereit, Ihnen
weiterzuhelfen.
Die Aufforderungen initiiert ein Benutzung des Systems durch den aktuellen Testkandidaten. Nähere Informationen zur des Systemtests sind im folgenden Abschnitt "User Interaction Logging" angeführt.
- Ich bitte Sie, das System jetzt zu bewerten. Kreuzen Sie bitte an, wie sehr
die folgenden Eigenschaften Ihrer Meinung nach auf das System zutreffen. Eigenschaften:
kompliziert, informativ, übersichtlich, visionär, einladend/auffordernd
und benutzerfreundlich.
Die Zuordnung der obengenannten Attribute zum System verweist auf seine Wirkung gegenüber potentiellen Besuchern. Die gewählten Eigenschaften sind Akzeptanz-Indikatoren für die medien.matrix.
- Was hat Ihnen im Umgang mit dem System besonders gefallen?
Die Frage zielt darauf ab, "Unique Selling Propositions" (einzigartige Wettbewerbsvorteile) des vorliegenden Informationssystems zu ermitteln, die eventuell zusätzlich betont werden können.
- Was hat Ihnen im Umgang mit dem System nicht gefallen?
Negatives Besucherfeedback kann auf immanente Schwachstellen des Prototypen hindeuten, auf die vor der endgültigen Implementierung reagiert werden sollte.
- Wie schätzen Sie sich im Umgang mit Internet und Multimedia ein?
Eventuell ist das Benutzerinterface noch nicht intuitiv genug und muß noch überarbeitet werden.
- Geschlecht, Alter und Beruf
Statistische Kriterien werden erfaßt, um die Heterogenität der Stichprobe sicherzustellen.
User Interaction Logging
Das vorliegende System wurde mit einer Protokollierungsfunktionalität versehen. So ergab sich die Möglichkeit, Aufenthaltsdauer und betrachtete Seiten auszuwerten, um Rückschluß auf das Navigationsverhalten der Besucher im Detail wie auch im Gesamten zu ermitteln. Ein "Testlauf" im System erzeugt etwa folgende Einträge in einem Logfile:
| 20020502 10:03:05 Matrixstruktur |
| 20020502 10:03:10 Matrixsegment Speicherung 1 |
| 20020502 10:03:17 Matrixfeld Bild/Antike: Leadtext |
| 20020502 10:04:20 Matrixfeld Bild/Antike: Subtext 1 |
| 20020502 10:04:53 Matrixfeld Ton/Antike: Leadtext |
| 20020502 10:06:02 Matrixfeld Ton/Mittelalter: Leadtext |
| 20020502 10:06:30 Matrixstruktur |
| 20020502 10:06:48 Matrixsegment Übermittlung 2 |
Tabelle 8: Ausschnitt aus einem medien.matrix-Logfile
Vorerhebungen
Vom Verfasser wurden zum Zeitpunkt der Abfassung der vorliegenden Arbeit erste Interviews und Testläufe durchgeführt. Die hierbei ermittelten Ergebnisse sind - aufgrund der geringen Stichprobengröße - nicht repräsentativ, lassen aber erste Trends erkennen:
- Die Benutzerfreundlichkeit des Systems wird mit "sehr gut" bewertet. Selbst Personen, die wenig bis gar nicht in der Benutzung von Computern geübt sind, finden sich auf Anhieb zurecht.
- Die Testkandidaten vergeben für das Systemattribut "informativ" durchgängig Bestnoten.
- Die graphisch gelungene Aufbereitung wird gelobt. Animierte Illustrationen, die für das endgültige System geplant sind, werden als attraktivitätssteigernd eingestuft.
- Kritikpunkt stellt die Einstiegsmaske dar: Durch einen "Vorspann",
der Highlights zeigt, erwiese sich das System von Beginn an einladend.
Ergebnisse der Arbeit 
Meine Arbeit behandelt in mehreren Kapiteln drei konzentrische Themenkreise: Museen als Bildungsinstitutionen, digitale Museumsinformationssysteme sowie die medien.matrix.
Die Präzisierung der didaktischen Aufgabe digitaler Museumsinformationssysteme steht dabei im Mittelpunkt der Betrachtung.
In der Einleitung stelle ich die Frage, ob das Museum der Zukunft der Unterhaltung oder der Vermittlung von Wissensinhalten verpflichtet ist. Ich formuliere anschließend die erste Hypothese, wonach Museen eine Bildungsaufgabe erfüllen, zu deren Umsetzung zeitgemäße Kulturtechniken heranzuziehen sind. Diese Annahme stützt sich auf mehrere Aspekte. Den Ausgangspunkt bildet die Tatsache, daß Museen einen öffentlichen Bildungsauftrag gegenüber der Gesellschaft einzulösen haben, der zudem gesetzlich verankert ist.
Ich sehe mich im Zuge meiner Recherche in meiner Hypothese bestätigt, wonach Museen per definitionem nicht dazu verpflichtet sind, Unterhaltung zu bieten. Wissen soll in adäquater Form vermittelt werden, etwa durch den gezielten Einsatz digitaler Medien, der durchaus Unterhaltungswert bieten kann.
Meine Arbeit versucht außerdem die Frage nach der Anwendung "traditioneller" und "neuer" Methoden in der Museumsdidaktik zu klären. Zu diesem Zweck wird die zweite Annahme getroffen: Digitale Vermittlung ist kein Ersatz für reale Unmittelbarkeit, aber eine sinnvolle Ergänzung. Nach den durch die Gestaltung und Evaluation des Prototypen der medien.matrix gewonnenen Erkenntnissen lassen sich für reale und virtuelle Ausstellungsgestaltung nun konkrete Aufgabenbereiche definieren.
Reale Schausammlungen ermöglichen ihren Besuchern authentisches Erleben
und stellen durch ihre Exponate einen unmittelbaren Bezug zu den Ausstellungsinhalten
her. Durch die materielle Erscheinung der Objekte und entsprechende Inszenierung
("Präsentation") ist ein räumlich-sinnliches Erfahren des
Sammlungs-Ambiente ("Aura") möglich. Schausammlungen sind meist
systematisch aufgebaut, die Exponate entsprechend klassifiziert.
Ein virtueller Ausstellungs- bzw. Informationsraum muß jedoch auf die Vorzüge physischer Unmittelbarkeit verzichten. Digitale Technologien bieten sich im Museumskontext weniger für die Kompensation als vielmehr zur Erweiterung traditioneller Vermittlungsmethoden an. Vertiefende Umfeldinformationen können auf multimediale Art und Weise geboten werden, graphische Simulationen zeigen real schwer vermittelbare Sachverhalte. Die Besucher können sich mit den Inhalten interaktiv auseinandersetzen, wenn diese untereinander vernetzt sind und eine assoziative Rezeption erlauben.
Einschränkend zur zweiten Hypothese können virtuelle Museen bzw. online-Ausstellungen genannt werden, die ausschließlich im World Wide Web verfügbar sind. Sie müssen ohne physische Repräsentanten auskommen, was umso mehr eine anschauliche Umsetzung der Inhalte erforderlich macht. Virtuelle Ausstellungen bieten den Vorteil, daß ihr Zielpublikum - geographisch uneingeschränkt - ein weltweites ist.
"Wie soll zwischen Inhalt (Wissen) und Form (Gestalt) gewichtet werden, damit ein Informationssystem seine Vermittlungsaufgabe erfüllt?" lautet die letzte wesentliche Frage meiner Arbeit. Meine Mitarbeit an der Konzeption und Umsetzung der medien.matrix half, Antworten zu finden, um diese dritte Hypothese zu überprüfen, nach der die Strukturierung inhaltlicher Konzepte die Voraussetzung für zielgerichtete graphische Umsetzung ist.
Dem vorliegenden System der medien.matrix kommt eine wesentliche Kontextualisierungsaufgabe
im Hinblick auf die Darstellung des erweiterten thematischen Umfeldes der Ausstellung
zu. Um diese erfüllen zu können, bildet eine vernetzte Textstruktur
die inhaltliche Basis. Auf dieser Grundlage erfolgt die graphische und auditive
Illustration.
Die Nachvollziehbarkeit der Darstellung (Visualisierung) von Inhalten erfordert - ausgehend von ihrem Nutzungskontext - die Überlegung, welche Vermittlungsmodelle (wie etwa Hypertext und Multimedia) auszuwählen sind. Anschließend ist eine Strukturierung der inhaltlichen Aspekte notwendig. Hierfür bieten sich verschiedene Werkzeuge, wie etwa hierarchische Klassifikation von Textelementen oder ihre Vernetzung durch Hyperlinks, an.
Die Erstellung sowie die Evaluation des Prototypen der medien.matrix weist auf einen wesentlichen Faktor hin, der das Verhältnis und das Zusammenspiel zwischen inhaltlicher Strukturierung und graphischer Umsetzung maßgeblich bestimmt: Die Auflösbarkeit der inhaltlichen Struktur sowohl auf Seiten der Ersteller als auch der Anwender.
Das Wissen um die Zielgruppe - die zukünftigen Nutzer des Museumsinformationssystems - soll bei der Erarbeitung der inhaltlichen Grundstruktur gegeben sein. Der rote Faden, der sich durch die Inhalte zieht, muß für die Benutzer ersichtlich sein, damit die textlichen Elemente eine verläßliche Basis des Systems darstellen. Dann erst erweisen sich graphische und auditive Umsetzungsformen als erfolgreich.
Die Zukunft der Wissensvermittlung

"Technologische Landschaften für die Kulturökonomie von morgen. Den Wert des kulturellen Erbes steigern" ist der Titel der DigiCULT-Studie, die von der Salzburg Research Forschungsgesellschaft im Auftrag der Europäischen Kommission, Generaldirektion Informationsgesellschaft durchgeführt wurde.
Für Europas Kulturinstitutionen, zu denen Bibliotheken, Archive und Museen gerechnet werden, ergeben sich in den nächsten Jahren neue Aufgabenfelder. Diese verwalten - im Zuge der Herausbildung der Wissensgesellschaft - heutzutage vermehrt hybride Bestände. Sie pflegen Sammlungen, die analoge wie auch digitale Quellen umfassen. Daraus ergeben sich neue Chancen für die betreffenden Institutionen, sich als Informations- und Wissensvermittler zu präsentieren. Der Forschungsbericht (Salzburg Research 2002) nennt unterschiedliche Herausforderungen, die ein zukünftiges Tätigkeitsfeld ergeben:
- Neubewertung des europäischen kulturellen Erbes
- Bildung als Schlüsselmarkt für digitale Dienstleistungen und Produkte des Kulturerbe-Sektors
- Zusammenarbeit und Partnerschaft als Schlüssel für Aktivitäten im vernetzten Raum
- Stärkung kleiner Institutionen durch Erhöhung ihrer Kompetenz und Kapazität
- Digitale Ressourcen und deren langfristige Erhaltung als wesentliche Faktoren für die technologische Entwicklung im Kultursektor
- Systematische und koordinierte Digitalisierung von Kulturbeständen
Der Punkt "Neubewertung des europäischen kulturellen Erbes" bezieht sich etwa auf den gesellschaftlichen Nutzwert von Kulturinstitutionen, den sie in Form von kulturellen und historischen Wissen besitzen und vermehrter als bisher anbieten sollen. Informations- und Kommunikationstechnologien müssen gezielt eingesetzt werden, damit (elektronische) Lern- und Interessensplattformen entstehen. Somit sind die Institutionen aufgefordert, neue Dienste und Serviceleistungen anzubieten. Die koordinierte Digitalisierung von Objekten, die Archivierung von Internet-Ressourcen und die parallel laufende Erfassung von Meta-Daten stellen weitere Tätigkeitsfelder dar.
Mit ihren Sammlungen und Fachwissenschaftern besitzen Museen ein wertvolles Vermittlungspotential, das sie der Gesellschaft - ihrem öffentlichen Bildungsauftrag gemäß - zur Verfügung stellen sollen. Auch, oder gerade mit historischen Objekten lassen sich gegenwärtige Phänomene und "Zeichen der Zeit" kontextualisieren, in einer umfassenderen Weise darstellen. Die Museumsbesucher von heute sind - im Zuge der Entwicklungen im Zeitalter der Informationsgesellschaft - dazu aufgefordert, als mündige Bürger ihre Interessen zu verfolgen und kritisch durchs Leben zu gehen. Daher muß sich das Museum neu ausrichten, sich seinen Zielgruppen als Diskussionsforum darbieten. Als Plattform soll sich die Institution nicht nur ihren Besuchern gegenüber öffnen, sondern auch zeitgemäße Vermittlungsmethoden einsetzen.
Der Verfasser führte am dritten April 2002 ein telefonisches Interview mit Herrn Michael Mikolajczak vom Heinz Nixdorf MuseumsForum in Paderborn. Die wichtigsten Passagen zum Thema Benutzer- und Zukunftsorientierung von Museen seien hier sinngemäß kurz wiedergeben:
Museen sollen Besucher beim lebenslangen Lernen begleiten und sich zusätzlich auch virtuell öffnen. Rückmeldungen seitens der Besucher sind erwünscht, seien es persönliche Gespräche, Einträge ins Gästebuch des Museums oder E-Mails.
Museen haben ein "Privileg der Kultur", daher müssen sie Wissensvermittlung betreiben. Komplexe Inhalte lassen sich durch intermuseale Kooperationen aufbereiten. Gedanken, Erfahrungen in der Museumslandschaft sollen vernetzt werden. Durch virtuelle gemeinsame Aktionsräume einzelner Museen ist für die Besucher ein ganzheitliches Erleben ermöglicht.
Das bedeutet aber keineswegs, daß reale Ausstellungen durch virtuelle Reiz- und Erlebniswelten ersetzt werden können. Digital-vernetzte Medien erlauben vielmehr, Inhalte, die sich auf "traditionelle" Weise nicht oder nur unzureichend aufbereiten lassen, in virtuellen Informationsräumen anzubieten.
Doch dieser Faszination (VR-Technologie, Anm. d. Verf.) zu erliegen, greift für ein Verständnis der neuen Technologien zu kurz und damit daneben. Sogenannte virtuelle Realitäten sind geschickt entworfene Reduktionen, die uns die Möglichkeit, neue Erfahrungen zu machen, gerade dadurch verschaffen, daß sie uns in mehrfacher Hinsicht einen Teil dieser Erfahrungswelt vorenthalten. (Keil-Slawik in Faßler, S.209)
Daraus folgt die Forderung nach funktionaler Spezialisierung analoger und digitaler Vermittlungsmedien, damit ihre didaktischen Vorzüge gezielter einsetzbar sind. Gedruckte Informationsbereitstellung in Textform erlaubt eine systematische und rationale Erfassung und Verarbeitung von Inhalten. Die Aufbereitung von Information in schriftlicher Form ist jedoch monomedial und daher auch monosensual, das heißt, sie fordert fast ausschließlich visuelle Rezeption.
Mit "Multimedia" und "Hypertext", den wichtigsten Errungenschaften digitaler Medientechnologie, werden verschiedene Sinne synchron angesprochen. Digitale Inhaltsaufbereitung erfordert größere Aufmerksamkeit, weil sie vernetzte und assoziative Informationsrezeption anbietet. Doch mit der Digitalität der Inhalte wird Virtualität erzeugt. Die Eigenschaft "virtuell" bezeichnet das Fehlen der physischen Komponente.
Durch Telekommunikation wird ein ortsungebundener und vernetzter Informationsaustausch möglich, interaktive Arbeits-, Lern- und Erlebnisumgebungen entstehen. Realität beschränkt die Kommunikation und den Erfahrungsbereich zwar orts- und zeitmäßig, jedoch konfrontiert sie unmittelbar und ermöglicht authentische Erfahrung und Auseinandersetzung mit der Umwelt.
Literaturverzeichnis 
ACM SIGCHI (Hg.) (1997): Definition and Overview of Human-Computer Interaction. - http://sigchi.org/cdg/cdg2.html
AMARAL, K. (1995): Hypertext and writing: An overview of the hypertext medium.- http://www.umassd.edu/Public/People/KAmaral/Thesis/hypertext.html
ASTD LEARNING CIRCUITS (Hg.) (2001): Know Thy Learner: The Importance of Context in E-Learning Design. - http://www.learningcircuits.org/2001/oct2001/elearn.html
AUFENANGER, St., Schulz-Zander R. & Spanhel, D. (Hg.) (2001): Jahrbuch Medienpädagogik 1. - Opladen (Leske + Budrich), 463 S.
BLUMENBERG, H. (1989): Höhlenausgänge. - Frankfurt a. M. (Suhrkamp Taschenbuch-Verlag), 827 S.
BOLLMANN, St. (Hg.) (1996): Kursbuch Neue Medien. Trends in Wirtschaft und Politik, Wissenschaft und Kultur. - Mannheim (Bollmann), 365 S.
BRITISH MUSEUMS ASSOCIATION (2002): Code of Ethics for Museums. - http://www.infosite.co.uk/masite/code_of_ethics.pdf
BUNDESMISITERIUM für Unterricht und kulturelle Angelegenheiten (Hg.) (1999):
507. Verordnung des Bundesministers für Unterricht und kulturelle Angelegenheiten
betreffend Museumsordnung des Technischen Museums Wien. - http://www.bgbl.at/CIC/BASIS/bgblpdf/www/pdf/DDD/1999B507.pdf
BUNDESMINISTERIUM für Bildung, Wissenschaft und Kultur (Hg.) (2002): 14. Bundesgesetz: Neue Erlassung des Bundesmuseen-Gesetzes. - http://www.bgbl.at/CIC/BASIS/bgblpdf/www/pdf/DDD/2002a01401.pdf
BUSH, V. (1945): As we may think. - In: Atlantic Monthly, Juli 1945, Vol. 176, No.1, S. 101-108 - http://www.theatlantic.com/unbound/flashbks/computer/bushf.htm
CANTER, D., Rivers., R. & Storrs, G. (1985): Characterising User Navigation through Complex Data Structures. - In: Behaviour and Information Technology, Jg. 1985, Volume 4, Issues 2, S. 93-102
CARD, St. K., Robertson, G. G. & York, W. (1996): The WebBook and the Web Forager: An Information Workspace for the World-Wide Web. - Palo Alto (Xerox Palo Alto Research Center) - http://www.parc.xerox.com/istl/projects/uir/pubs/pdf/UIR-R-1996-14-Card-CHI96-WebForager.pdf
CERN (Hg.) (1997): An overview of the World Wide Web. - http://public.web.cern.ch/Public/ACHIEVEMENTS/WEB/Welcome.html
COMPANIA MEDIA (Hg.) (1998): Neue Medien in Museen und Ausstellungen. Einsatz
- Beratung - Produktion. Ein Praxis-Handbuch. - Bielefeld (transcript-Verlag),
516 S.
DÄßLER, R. (1999): Das Einsteigerseminar VRML. - Kaarst (bhv-Verlag), 416 S.
DIX, A. J., Finlay, J. E, Abowd, G. D. & Beale, R. (1999): Human Computer Interaction. (Second Edition). - Harlow (Pentrice Hall Europe), 638 S.
FAßLER, M. & Halbach, W. R. (1994): Cyberspace: Gemeinschaften, virtuelle Kolonien, Öffentlichkeiten. - München (Fink), 299 S.
EUROPÄISCHE KOMISSION (2002): Auf dem Weg zur Informationsgesellschaft. - In: Information Society - http://europa.eu.int/information_society/index_de.htm
GEMMEKE, C., Hartmut, J. & Krämer, H. (Hg.) (2001): Euphorie digital? Aspekte der Wissensvermittlung in Kunst, Kultur und Technologie. - Bielefeld (transcript-Verlag), 257 S.
GIBSON, W. (1984): Neuromancer. - New York (Ace Books), 278 S.
HOFFMAN, M. (2000): Clarifying the real goals of hypertext. - http://www.hypertextnavigation.com/htgoals.htm
INTERNATIONAL COUNCIL OF MUSEUMS (ICOM) (Hg.) (1996): Introduction to Multimedia in Museums. - http://www.rkd.nl/pblctns/mmwg/print.htm
INTERNATIONAL ORGANISATION FOR STANDARDIZATION (ISO) (Hg.) (1996): Ergonomic Requirements for office work with visual display terminals (VDTs) - Part 10: Dialogue principles (ISO 9241-10: 1995). - http://wwwvis.informatik.uni-stuttgart.de/ger/teaching/lecture/ws01/sw-ergonomie/iso9241.pdf [europäische Norm, deutsche Fassung] [Authentifikation]
JANKO, S., Leopoldseder H. & Stocker, G. (1996): Ars Electronica Center. Museum der Zukunft. - Linz (AEC), 128 S.
JOHNSON, S. (1999): Interface Culture. Wie neue Technologien Kreativität und Kommunikation verändern. - Stuttgart (Klett-Cotta), 296 S.
KEENE, S. (1998): Digital Collections: Museums and the Information Age. - Oxford (Butterworth-Heinemann), 141 S.
KLOOCK, D. & Spahr, A. (2000): Medientheorien. Eine Einführung. - München (W. Fink), 293 S.
KUHLEN, R. (1999): Was bedeutet informationelle Autonomie? - http://www.inf-wiss.uni-konstanz.de/People/RK/Texte/archiv99.html
LAUE, G. (1999): Wunder kann man sammeln. - Kunstkammer Georg Laue (München), 115 S.
LORD, G. D. & Lord, B. (Hg.) (1999): The Manual of Museum Planning. - New York (Altamira Press), 462 S.
MERKL, D. (2001): Information Retrieval. (Vorlesungsskriptum) - Wien (Technische Universität, Institut für Softwaretechnik) - http://www.ifs.tuwien.ac.at/~dieter/FHE/
MÜNZ, St. (2001): SELFHTML - HTML-Seiten selbst erstellen. - http://selfhtml.teamone.de
PENSOLD, W. (2001): "...eine leicht bewegliche Waffe...". Zur Geschichte staatlicher Nachrichtenagenturpolitik in Österreich. (Dissertation) - Wien (Universität Wien, Fakultät für Human- und Sozialwissenschaften)
PHAROS INTERNATIONAL (Hg.) (2001): Science Week @ Austria 2001. - http://www.scienceweek.at/english.html
QUÉAU, Ph. (1996): Die virtuellen Orte. - http://www.heise.de/tp/deutsch/special/sam/6021/1.html
SALZBURG RESEARCH (Hg.) (2002): DigiCULT - Technological Landscapes for Tomorrow's Cultural Economy. - http://www.salzburgresearch.at/fbi/digicult/downloads/dc_es_german_020307screen.pdf
SCHULMEISTER, R. (1997): Grundlagen hypermedialer Lernsysteme. Theorie - Didaktik - Design. - München (R. Oldenburg Verlag), 495 S.
SKAGESTAD, P. (2000): Peirce, Virtuality, and Semiotic. - http://www.bu.edu/wcp/Papers/Cogn/CognSkag.htm
SMITH, P. A., Newman I. A. & Parks L. M. (1997): Virtual hierarchies and virtual networks: some lessons from hypermedia usability research applied to the World Wide Web. - In: Int. J. Human-Computer Studies (1997) 47, S. 67-95 - http://ijhcs.open.ac.uk/smith/
STOLL, C. (1999): LogOut. Warum Computer nichts im Klassenzimmer zu suchen haben und andere High-Tech-Ketzereien. - Frankfurt a. M. (S. Fischer), 252 S.
WAIDACHER, F. (1999): Museum lernen: Lange Geschichte einer Verweigerung oder: warum Museen manchmal so gründlich daneben stehen. - In: Museologie online - http://www.vl-museen.de/m-online/99/99-2.htm
WAIDACHER, F. (2000): Vom Wert der Museen. - In: Museologie online - http://www.hco.hagen.de/museen/m-online/00/00-1.pdf
WEB-BASED EDUCATION COMMISSION (Hg.) (2000): The Power of the Internet for Learning. - http://www.ed.gov/offices/AC/WBEC/FinalReport/WBECReport.pdf
WEITZE, M.-D. (Hg.) (2001): Public Understanding of Science im deutschsprachigen Raum: Die Rolle der Museen. - München (VGL - Deutsches Museum), 193 S.
WIECHERT, H. (1998): 3D-Visualisierungstechniken zur Navigation in Hypertextstrukturen
- Eine vergleichende Bewertung nach software-ergonomischen Kriterien. - Arnstadt
(Universität Gesamthochschule Paderborn), 104 S. - http://iug.uni-paderborn.de/iug/veroeffentlichungen/arbeiten/HWiechert.pdf
(Alle verwendeten online-Quellen wurden am 21. 5. 2002 auf Verfügbarkeit
getestet)
Abbildungsnachweis 
Abbildung 1: Traditionelle und zukünftige Wissensvermittlung
Abbildung 2: Ausstellungsgrundriß der medien.welten
Abbildung 3: Human-Computer Interaction - Umfeld
Abbildung 4: Interaktionsprozeß zwischen Mensch und Computer
Abbildung 5: Klassifikation von Informationssystemen nach ihrer Interaktivität
Abbildung 6: Grundmodell des Information Retrieval
Abbildung 7: Informationsstrukturierungsschemata im Vergleich
Abbildung 8: Informationscontainer der medien.matrix
Abbildung 9: Gallery - Room 13 East Wall
Abbildung 10: Web Forager
Abbildung 11: Durchblättern eines "WebBooks"
Abbildung 12: Suche mit der "DocumentLens"
Abbildung 13: Hot Sauce
Abbildung 14: Ausschnitt aus einer Mandelbrot-Menge
Abbildung 15: Timeline
Abbildung 16: Starlight
Abbildung 17: Cat-a-Cone: Visualisierung einer Suche in der Datenbank
"Medline"
Abbildung 18: "Kugel-Designer"
Abbildung 19: "The Human Mind"
Abbildung 20: XML-Strukturierungsschema für ein Matrixfeld
Das Titelbild ist ein Kupferstich aus: NEICKELIO, C. F. (1727): MUSEOGRAPHIA Oder Anleitung Zum rechten Begriff und nützlicher Anlegung der MUSEORUM, Oder Raritäten=Kammern,... In beliebter Kürze zusammen getragen, und curiösen Gemüthern dargestellt... Auf Verlangen mit einigen Zusätzen und dreyfachem Anhang vermehret von D. Johann Kanold. - Leipzig und Breslau (Hubert).
Abbildung 2 wurde vom Technischen Museum Wien erstellt.
Abbildung 3 ist entnommen aus: ACM SIGCHI (2002): Human-Computer Interaction. - http://sigchi.org/cdg/figure_1.gif
Abbildung 4 ist entnommen aus: DIX, A. J., Finlay, J. E, Abowd, G. D. & Beale, R. (1999): Human Computer Interaction, S. 107
Abbildung 5 wurde entnommen aus Interactivity of Multimedia Systems (online-Version von SCHULMEISTER 1997). - http://www.izhd.uni-hamburg.de/paginae/Book/screens/midoro%2Folimpo.gif
Abbildung 6 ist entnommen aus: MERKL: Information Retrieval (2001)
Abbildung 7 wurde entnommen aus SONG, J. (2002): Lecture 07 - Developing E-Business Sites. - http://jsong.ba.ttu.edu/ISQS5338/Spring2002/Lecture07.ppt
Die Abbildungen 9 und 15 sind entnommen aus: CORBIS PRODUCTIONS (1995): A Passion for Art: Renoir, Cézanne, Matisse, and Dr. Barnes. - CD-ROM
Die Abbildungen 10, 11 und 12 sind entnommen aus: CARD, St. K., Robertson, G. G. & York, W. (1996): The WebBook and the Web Forager: An Information Workspace for the World-Wide Web.
Die Abbildungen 13, 16 und 18 sind entnommen aus: CYBER-GEOGRAPHY RESEARCH (2002): An Atlas of Cyberspaces. - http://www.cybergeography.org/atlas/atlas.html
Abbildung 17 (http://www.sims.berkeley.edu/~hearst/papers/cac-sigir97/cat-radiation.jpg) wurde entnommen aus: HEARST, M. A., Karadi, Ch. (1997): Cat-a-Cone: An Interactive Interface for Specifying Searches and Viewing Retrieval Results using a Large Category Hierarchy. - In: Proceedings of 20th Annual International ACM/SIGIR Conference on Research and Development in Information Retrieval. - Philadelphia (ACM/SIGIR) - http://www.sims.berkeley.edu/~hearst/papers/cac-sigir97/sigir97.html
Alle übrigen Abbildungen wurden vom Verfasser selbst erstellt.
Tabellenverzeichnis 
Tabelle 1: Mit der Arbeit assoziierte Themenbereiche 4
Tabelle 2: Informationsstrukturierungswerkzeuge 30
Tabelle 3: Skizzierte Entwürfe der medien.matrix 41
Tabelle 4: Graphische Umsetzung der medien.matrix 42
Tabelle 5: Datenbankstruktur der medien.matrix 45
Tabelle 6: Konkretisierungsinstrument für Illustrationsskizzen 48
Tabelle 7: Beispiel einer Definition einer Matrixfeld-Illustration 48
Tabelle 8: Ausschnitt aus einem medien.matrix-Logfile 53
Die Illustrationen in Tabelle 2 sind entnommen aus GSM Software Management AG (Hg.) (1998): 4.3 Structuring the Information Space http://www.gsm.de/musist/mstyle_l7.htm#InfoSpace_Structuring
Die Illustrationen aus Tabelle 3 stammen von Herrn Mag. Wolfgang Pensold.
Alle übrigen tabellarischen Übersichten wurden vom Verfasser selbst
erstellt.
Kurzbiographie zum Autor 
Name: Leonhard Huber
Geboren: 29. Juli 1980
Kontaktadresse:
Hohe Wand-Gasse 20,
2700 Wiener Neustadt
Telefon: (+43) (0)2622
222114
Telefax: (+43) (0)2622 222113
E-Mail: huber@digiart.at
Homepage: http://www.digiart.at/huber/
Ausbildung
1986-1990: Volksschule in Wr. Neustadt
1990-1998: Bundesgymnasium Zehnergasse, Wr. Neustadt
1998-2002: Fachhochschul-Studiengang Informationsberufe, Eisenstadt
Praktika, Ferialjobs
Jänner
1999: Literaturarchiv der Österreichischen Nationalbibliothek, Wien
Juli 1999: Futurelab, Ars Electronica Center, Linz
August 2000: Abteilung
Information und Kommunikation, Technisches Museum, Wien
Juli bis August 2001:
pressetext.austria Nachrichtenagentur AG, Wien
seit September 2001: Ausstellungsgestaltung
medien.welten, Technisches Museum, Wien
Auszeichnungen bei Wettbewerben
Prix Ars Electronica 1998 (Auszeichnung U19-Kategorie)
Österreichische
Computer-Gesellschaft (Jugendinformatikwettbewerb)
Niederösterreichische
Arbeiterkammer ("Schüler machen EDV-Programme")
Raiffeisenregionalbank
Wr. Neustadt (Homepage-Wettbewerb)
Computerkenntnisse
Programmiersprachen (Turbo Pascal, Visual Basic, Delphi, Java)
Internet-Technologien (HTML, JavaScript,
Perl, PHP, XML, ...)
Datenbanken (MySQL, Oracle, SQL-Server, ...)
Graphikbearbeitung
(Photoshop, PageMaker, 3D-Studio Max, VRML, Shockwave, ...)
Audio-Software
(Cool Edit, Cakewalk, Finale Allegro, ...)
Künstlerische Tätigkeit
1986-1997: Klavierunterricht, Musikschule, Wr. Neustadt
seit 1998 einige Eigenkompositionen
verschiedene Kunstprojekte, besonders erwähnenswert sind:
DigiArt - audio-visuelle Kunst - http://www.digiart.at
Skulptur.net - online-Galerie für bildende Künstler - http://www.skulptur.net
URL: http://, druckbare Version
Erstellt am 07. 07. 2002,
Letztes Update: 21. 09. 2002